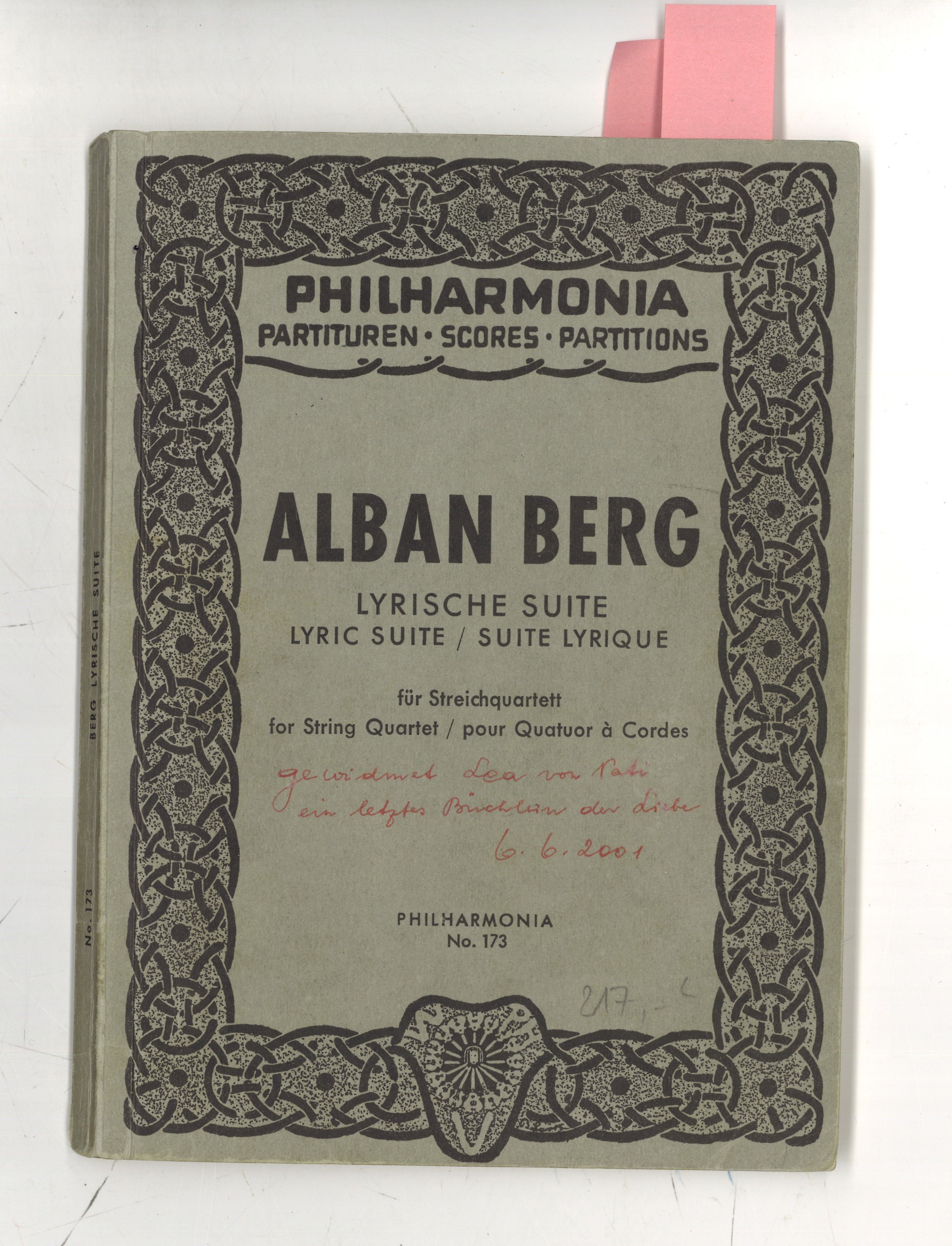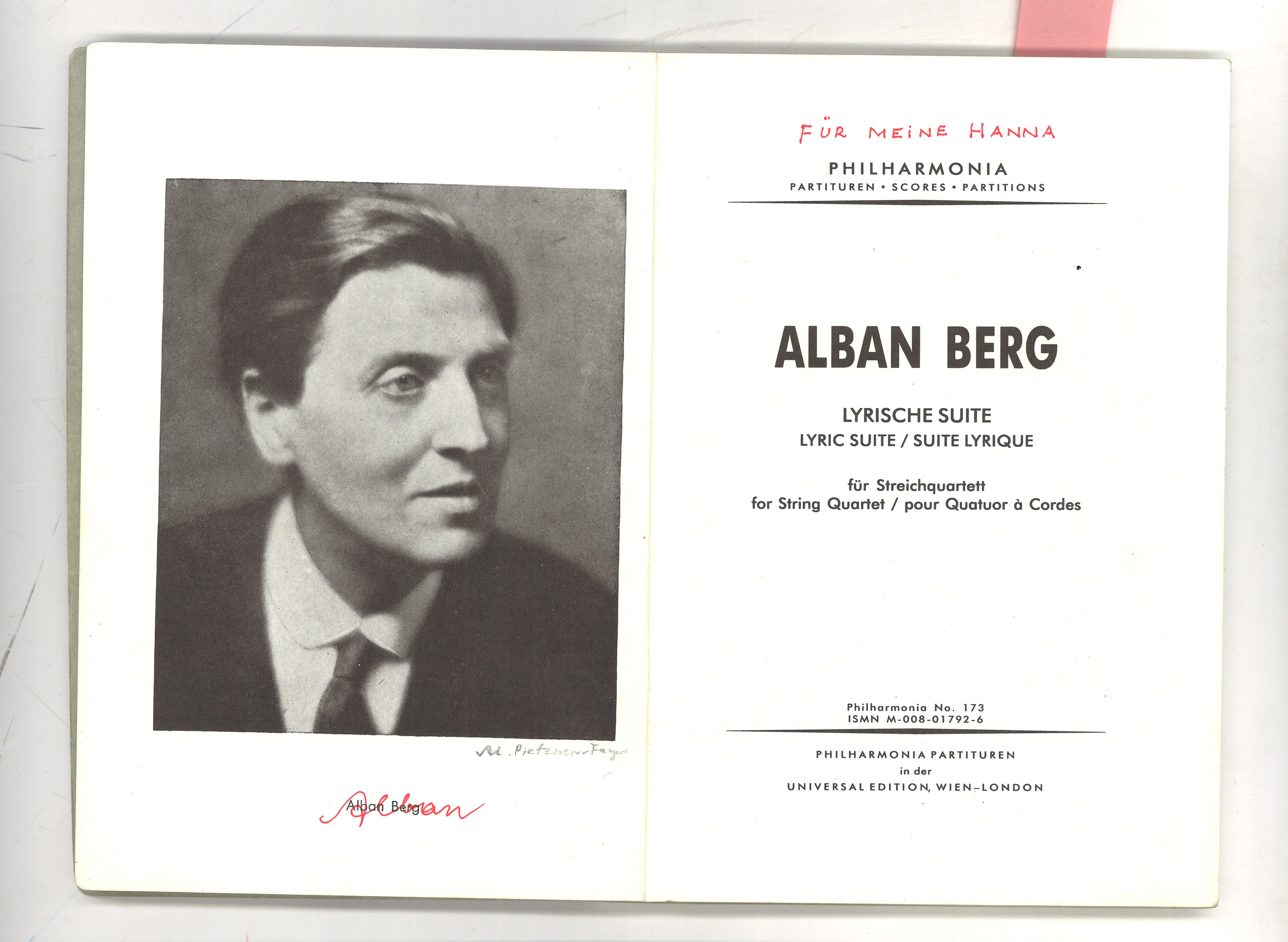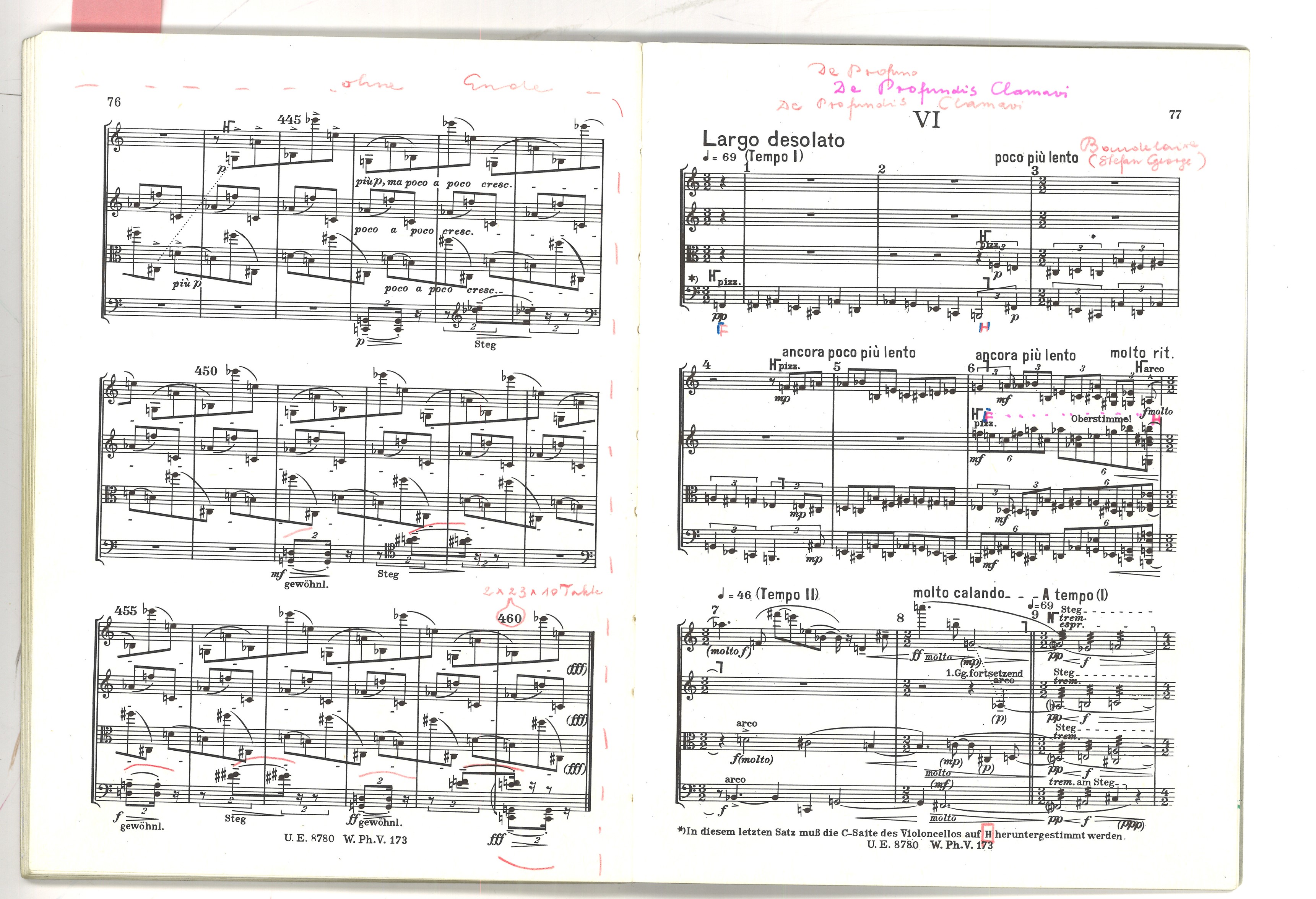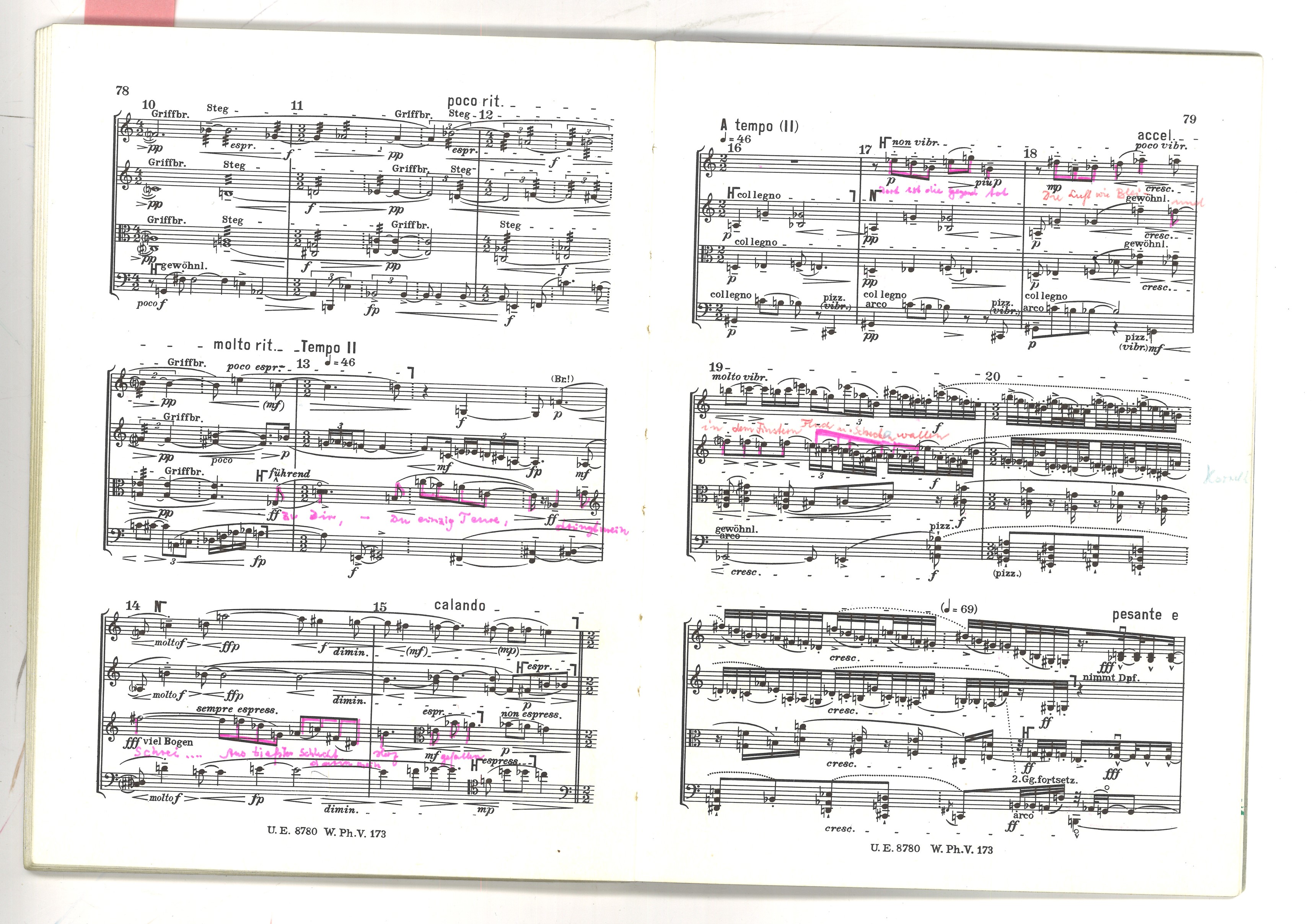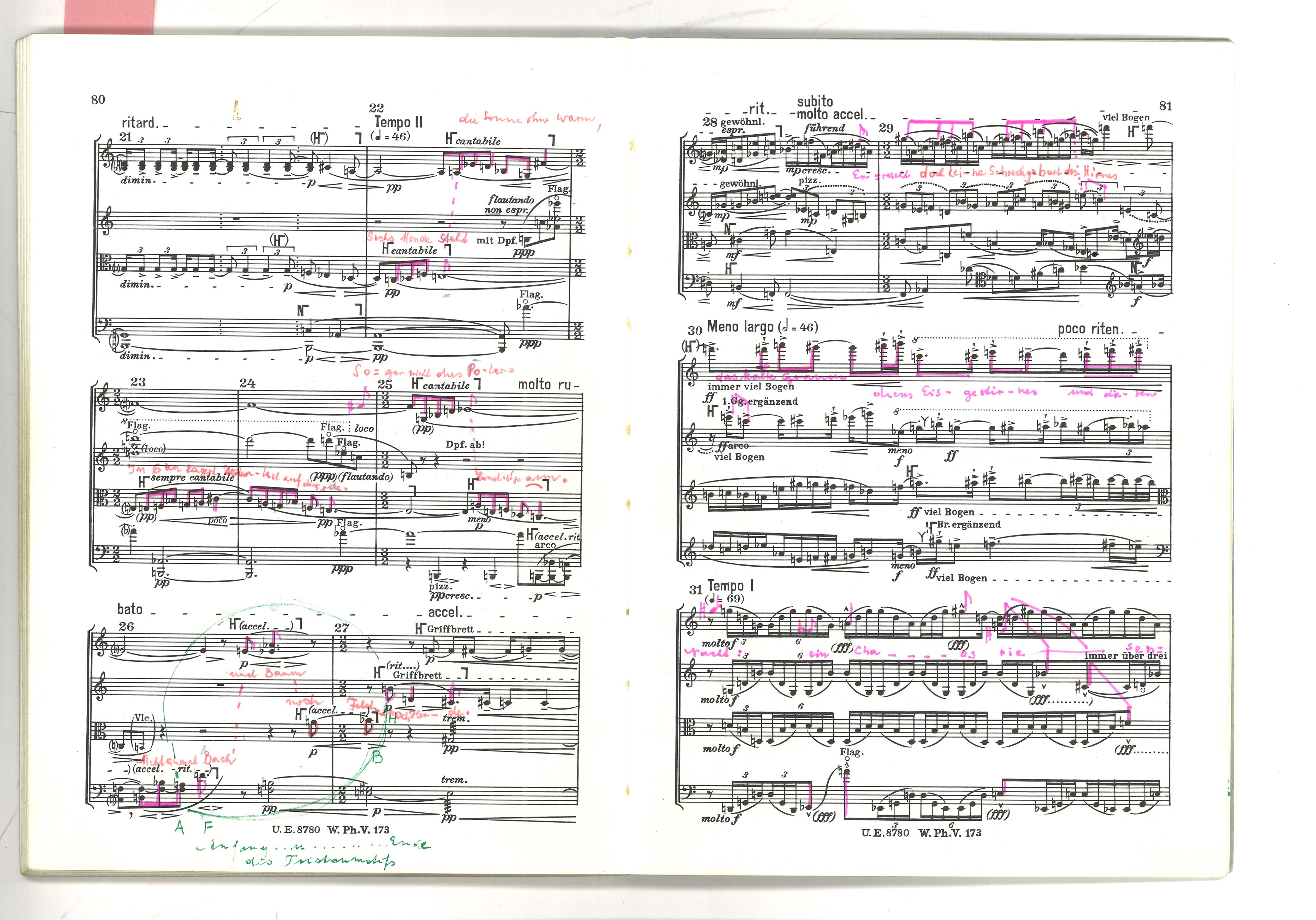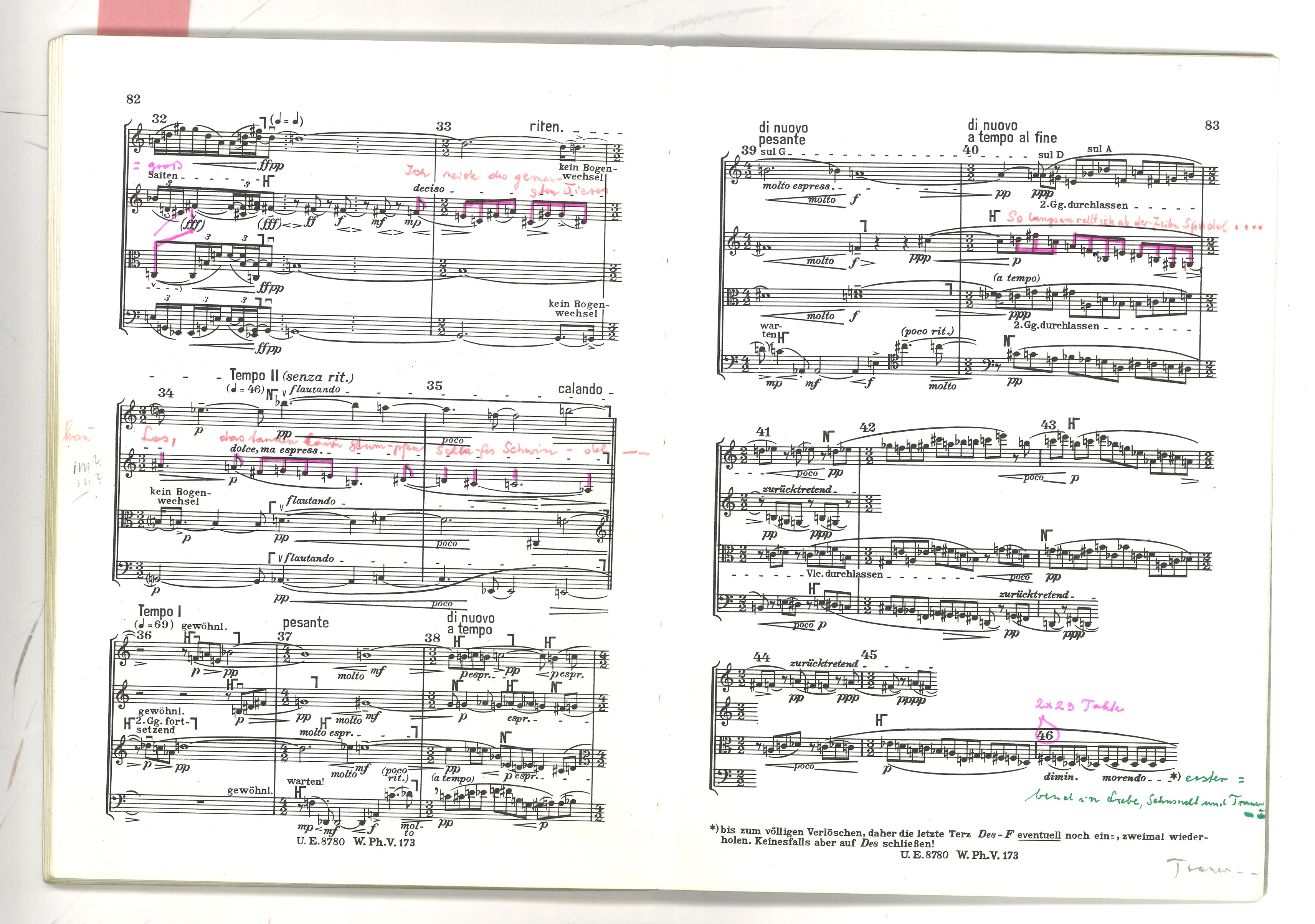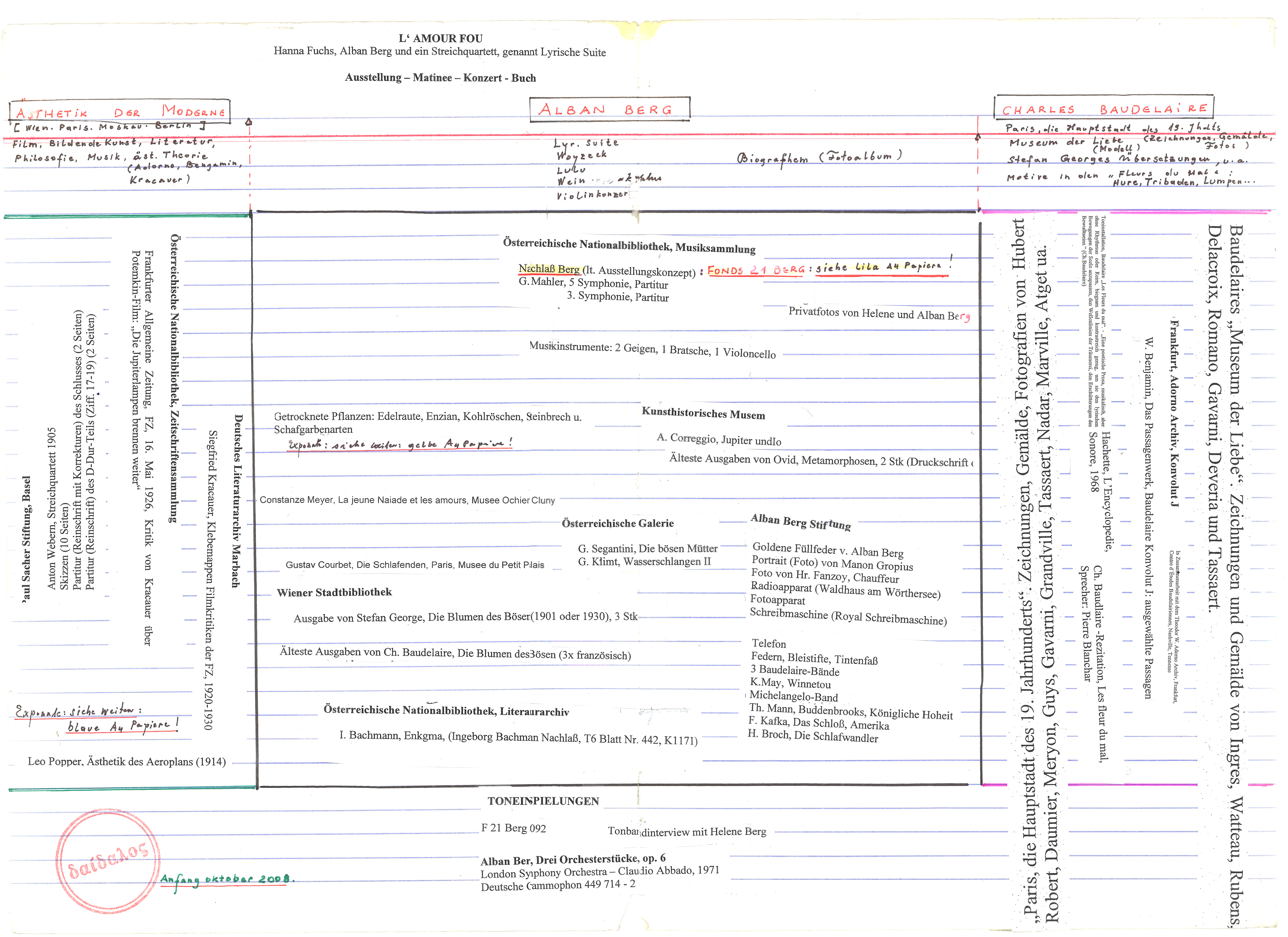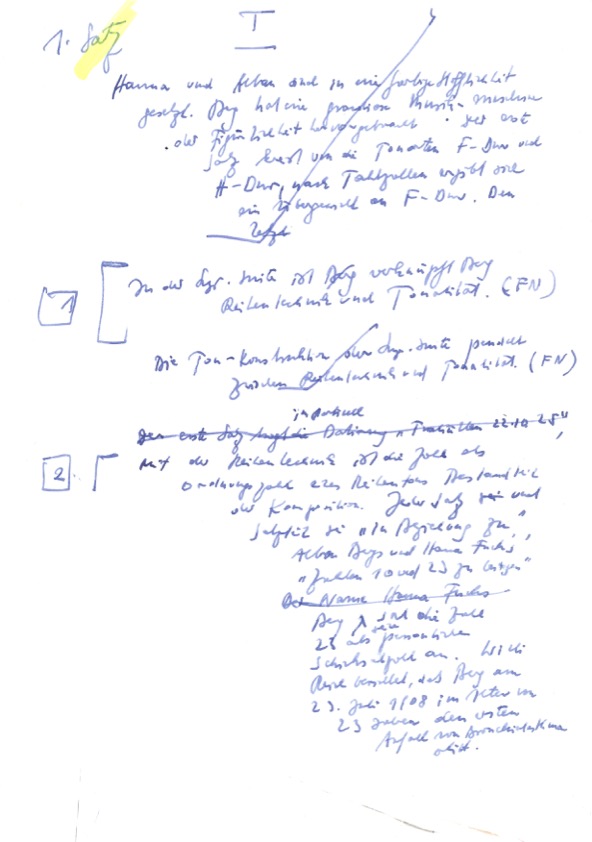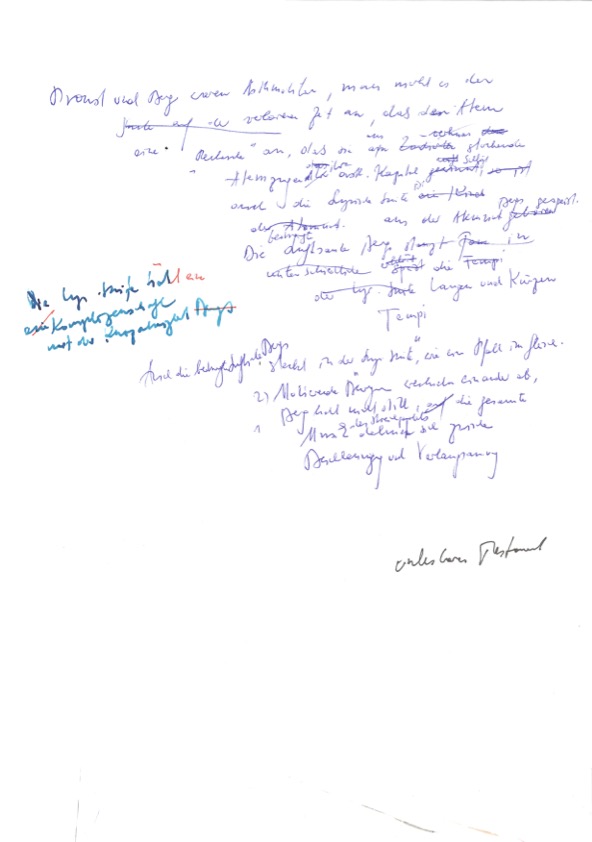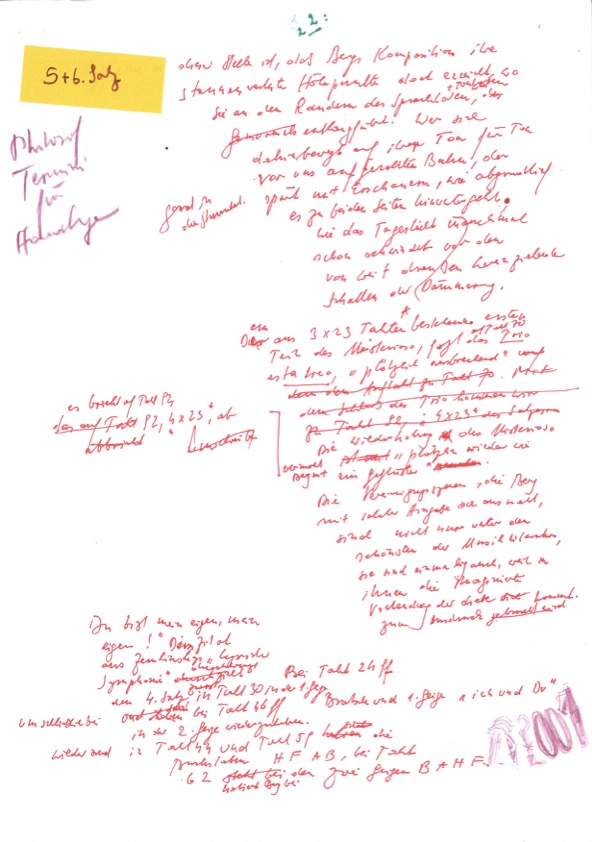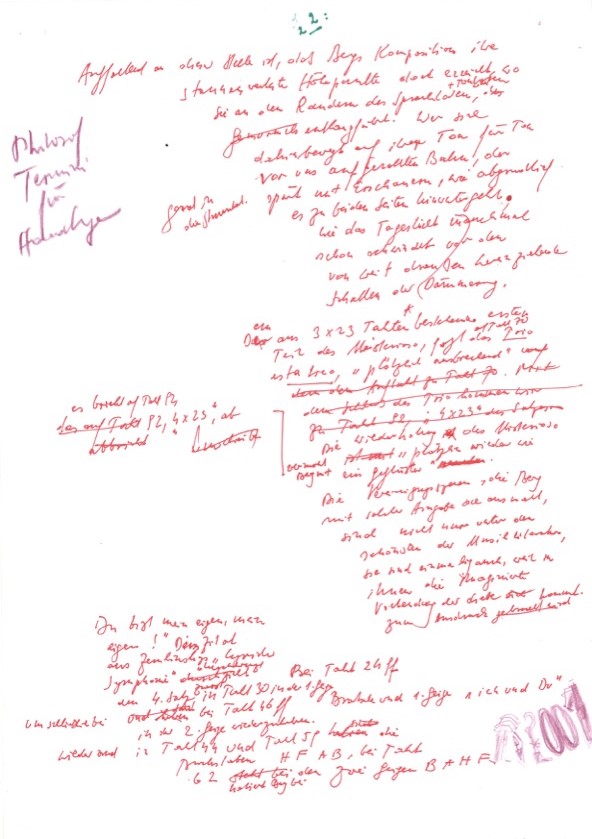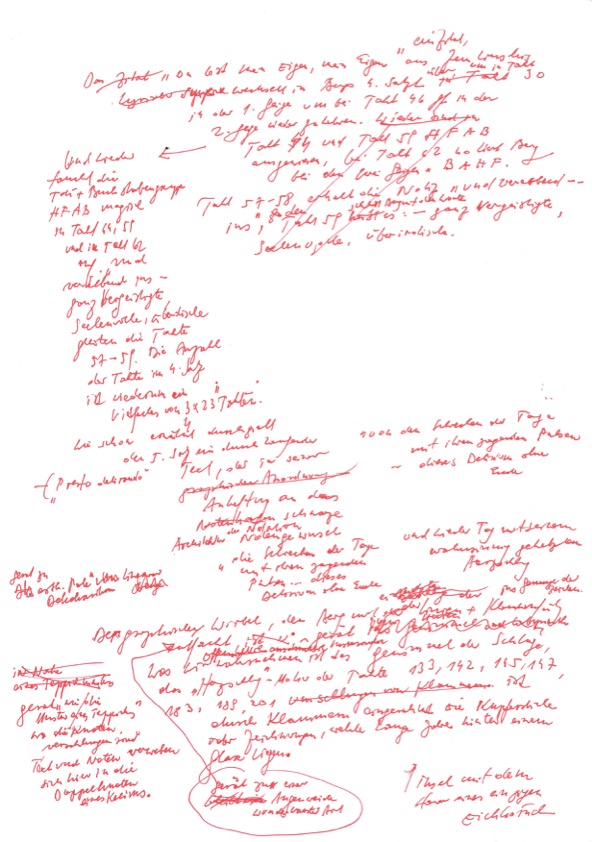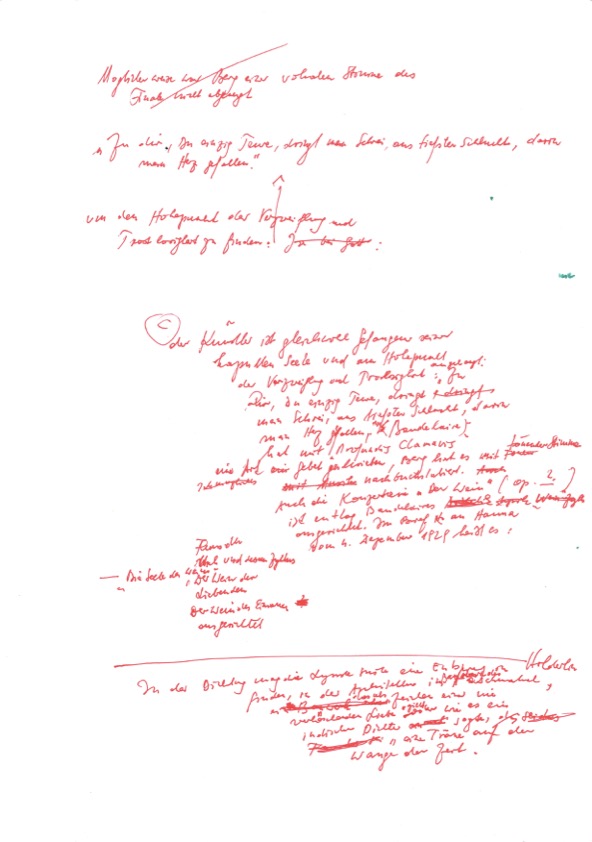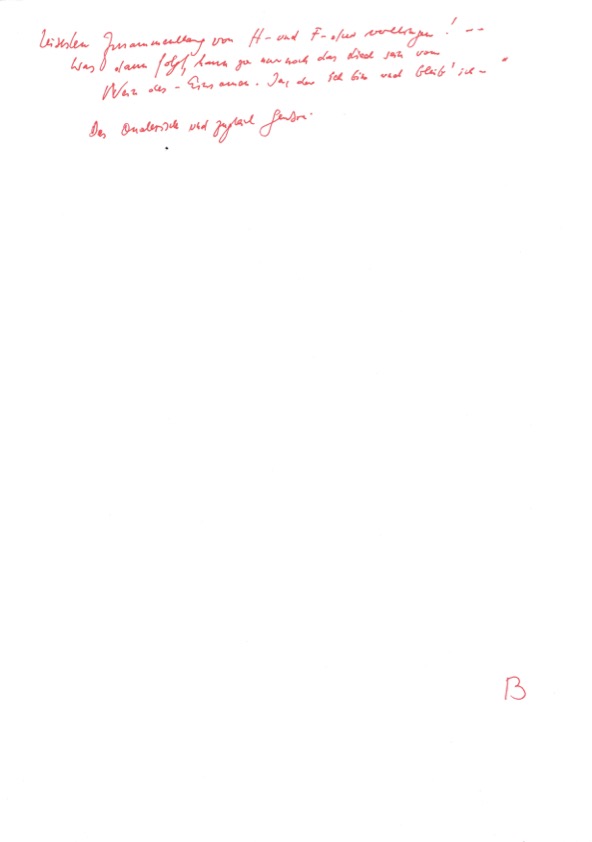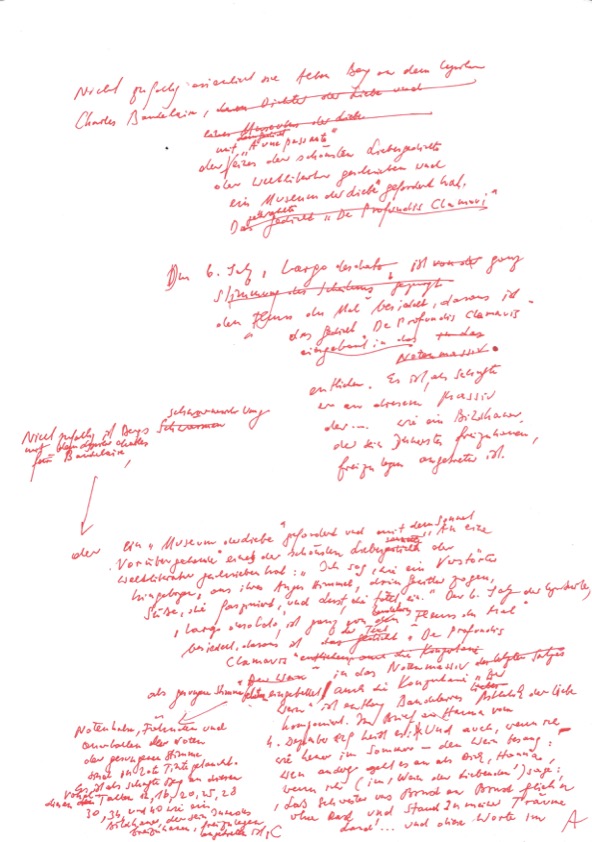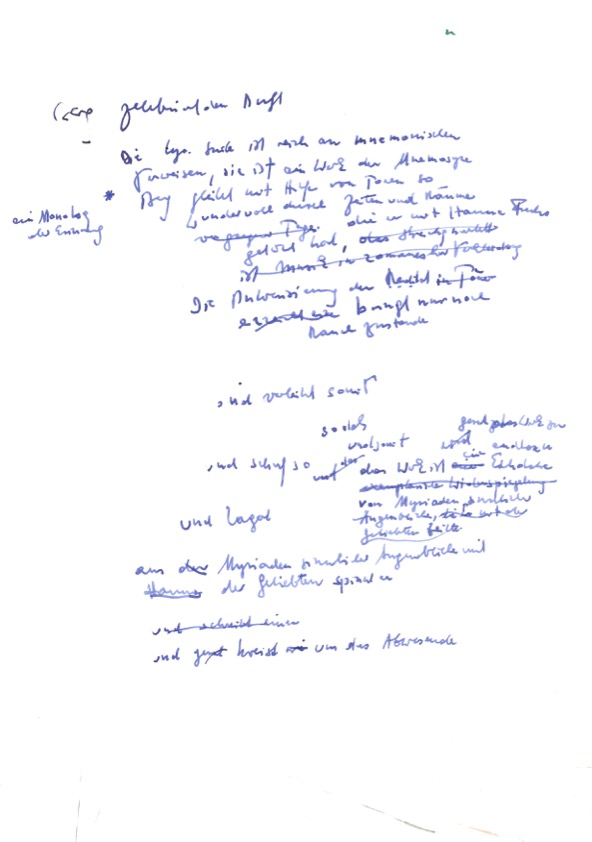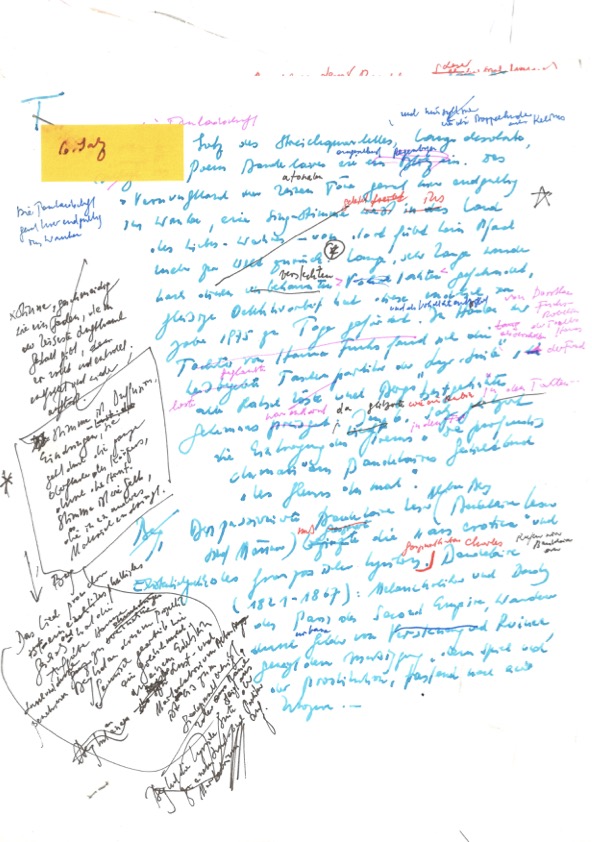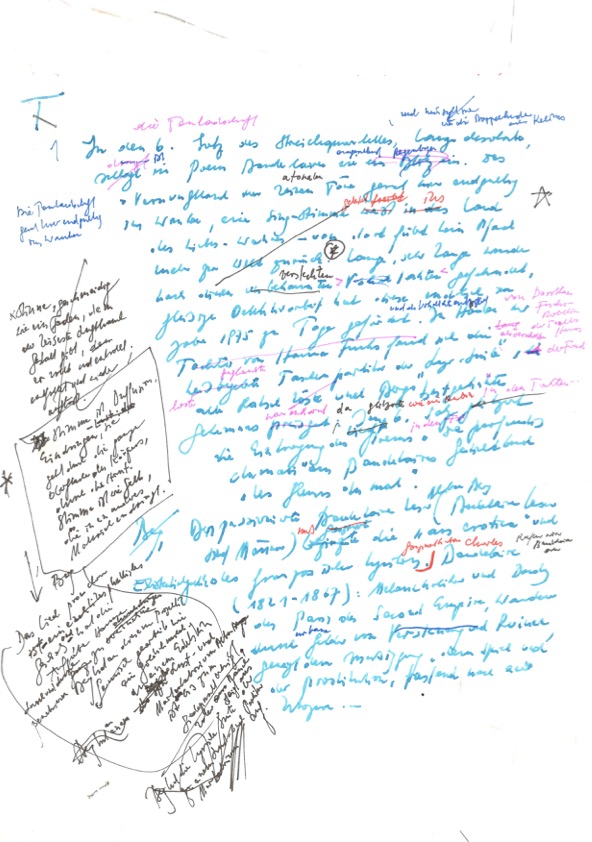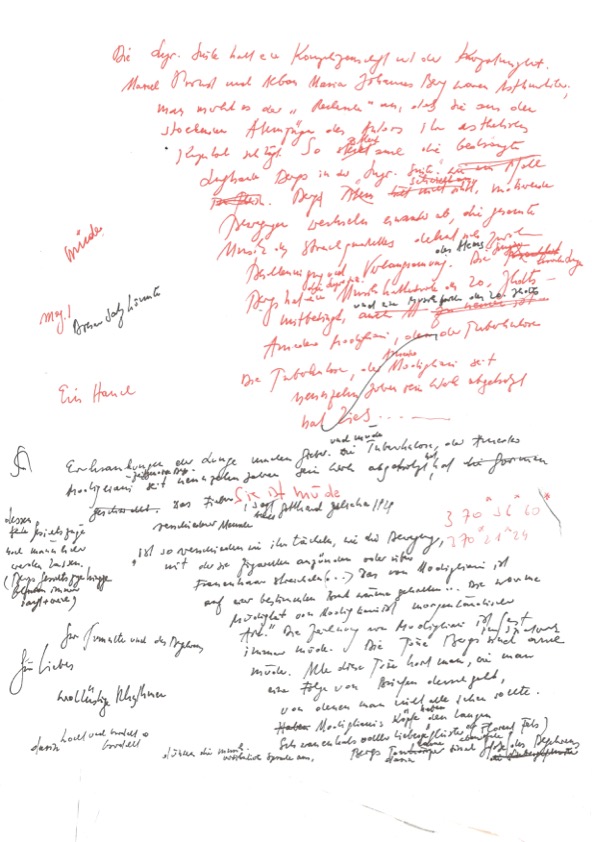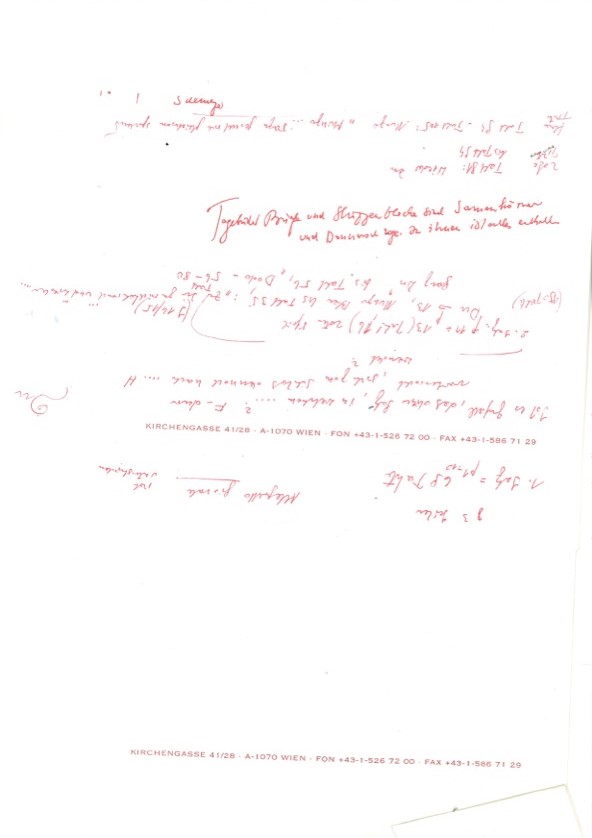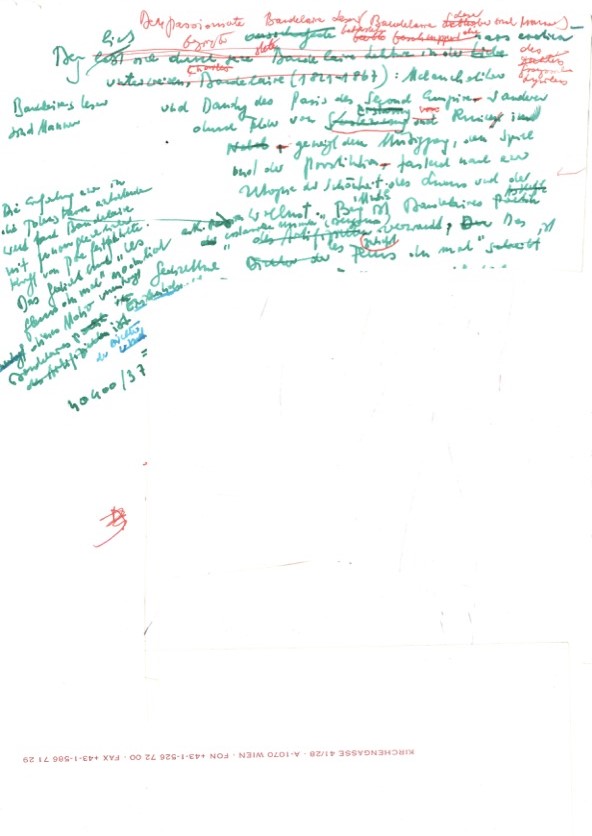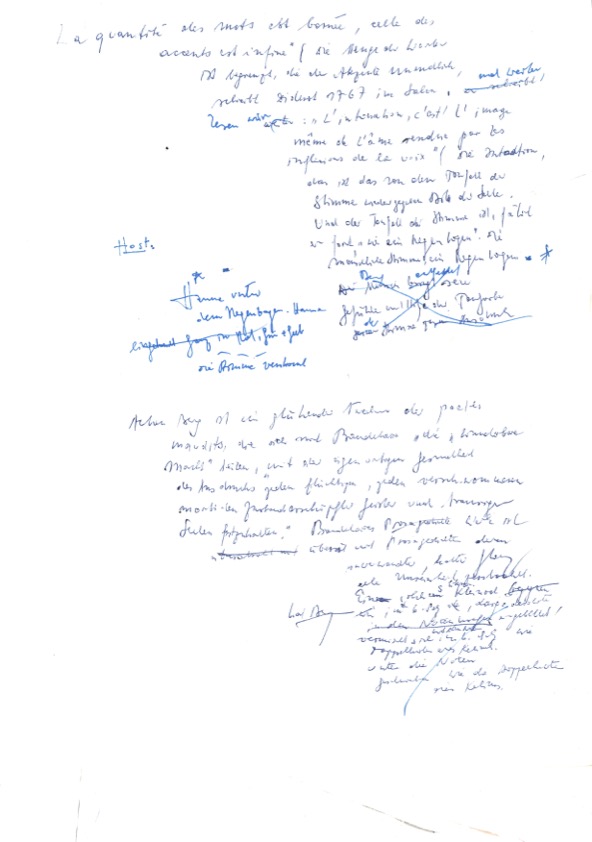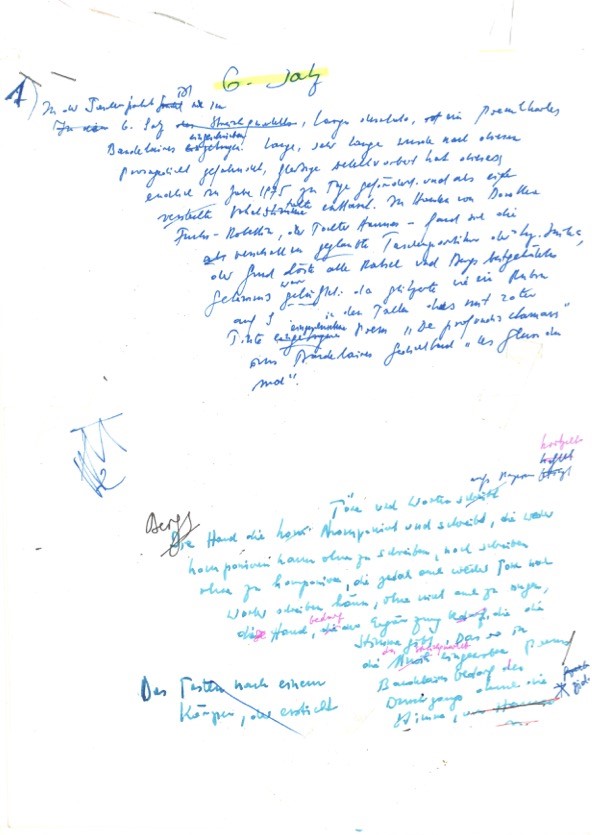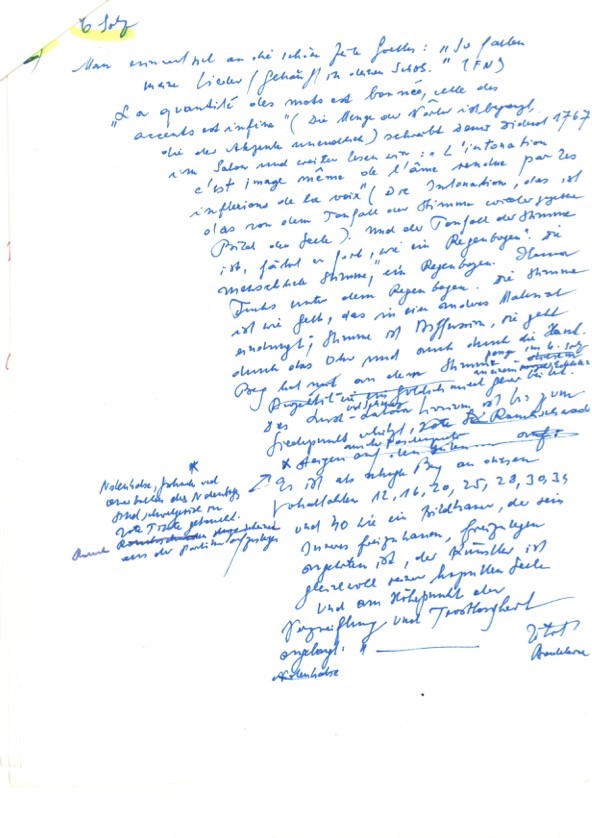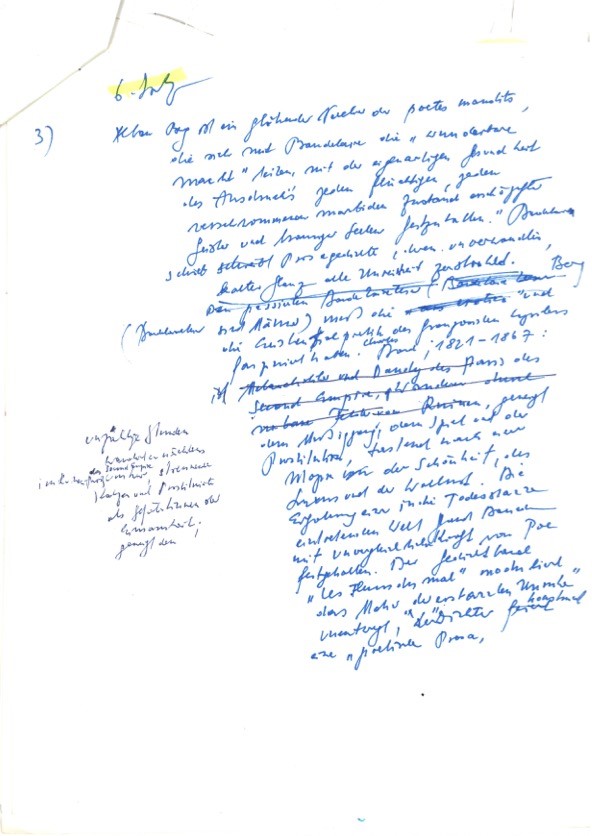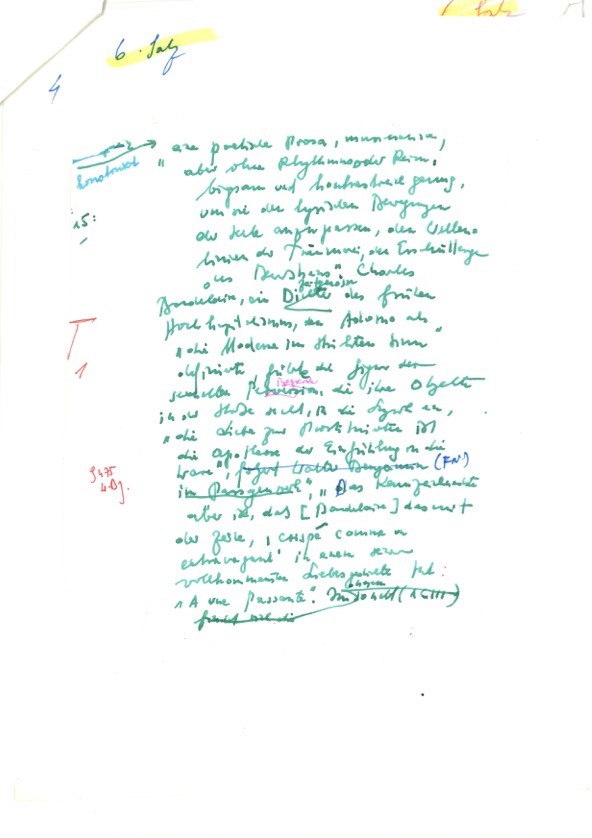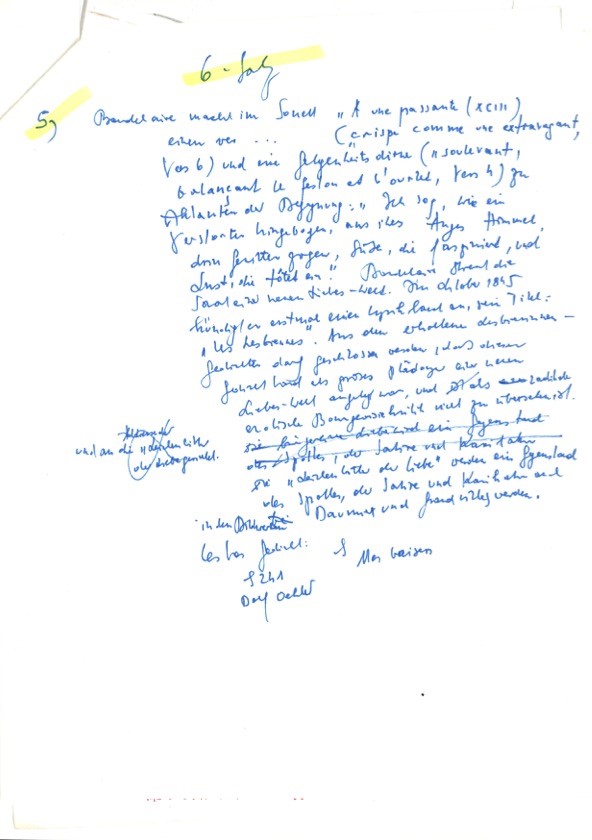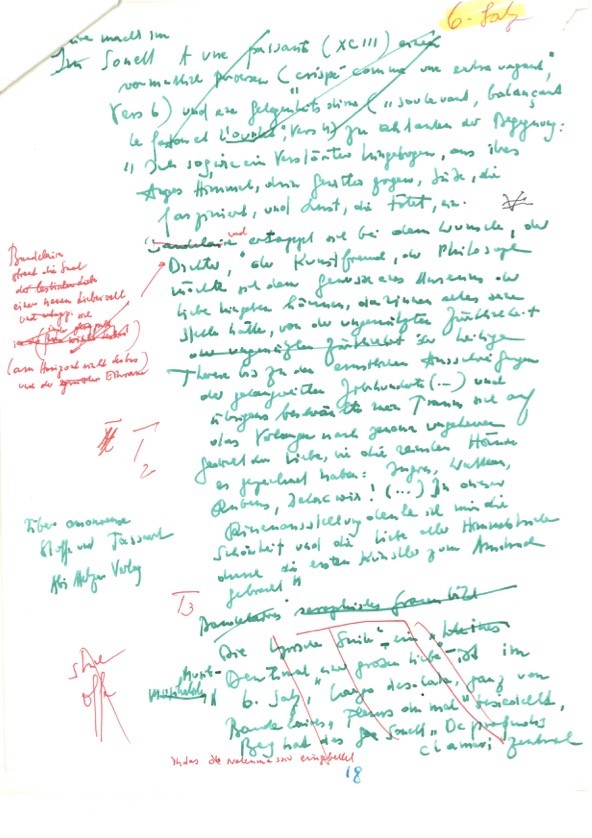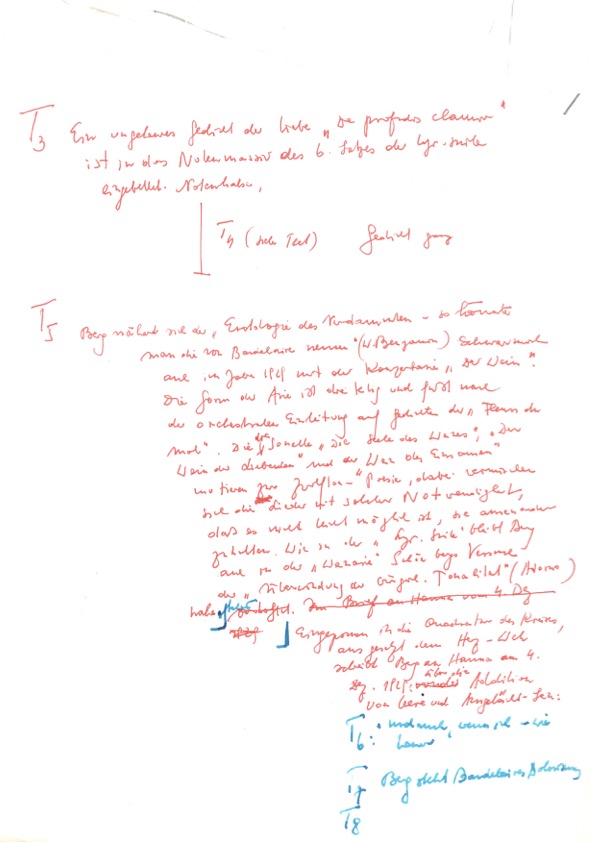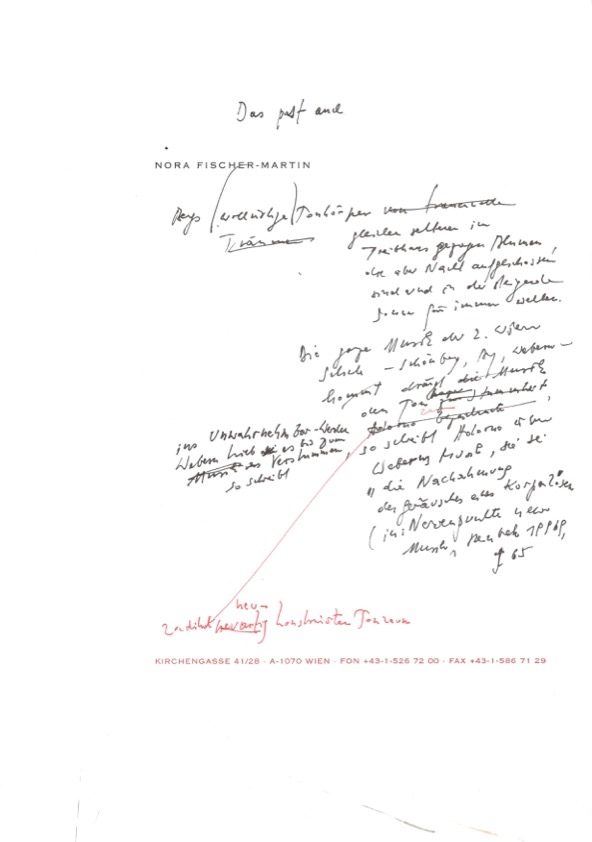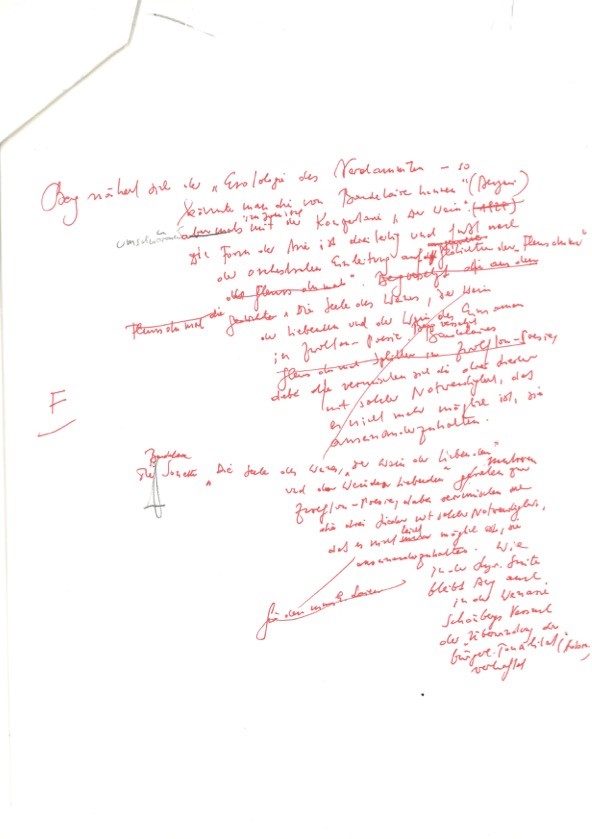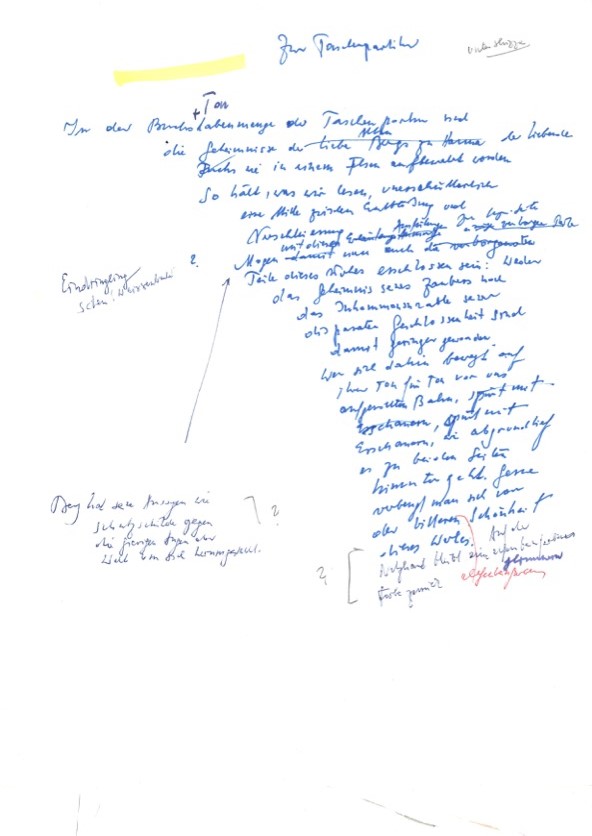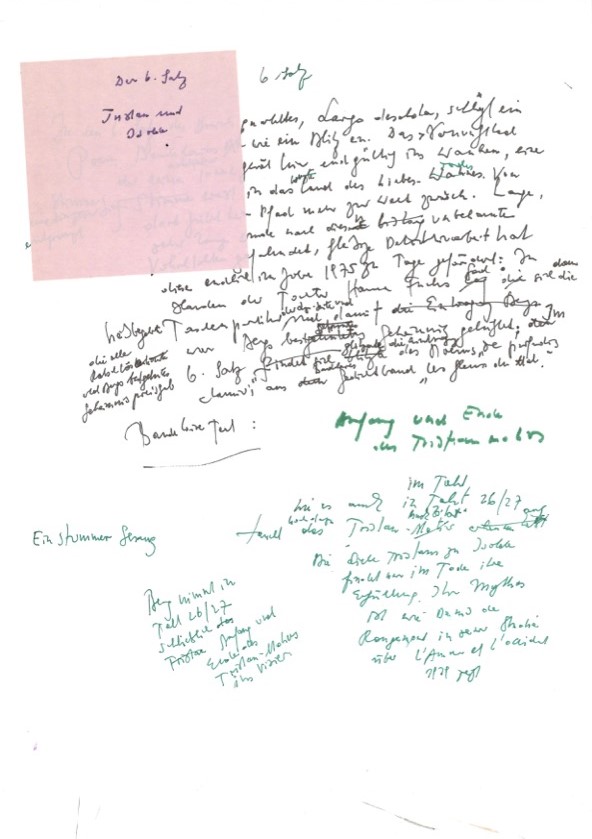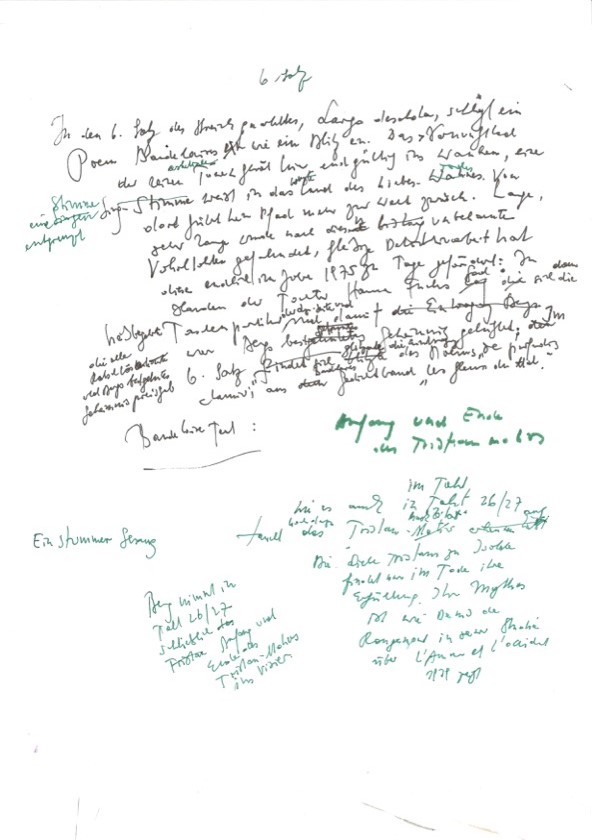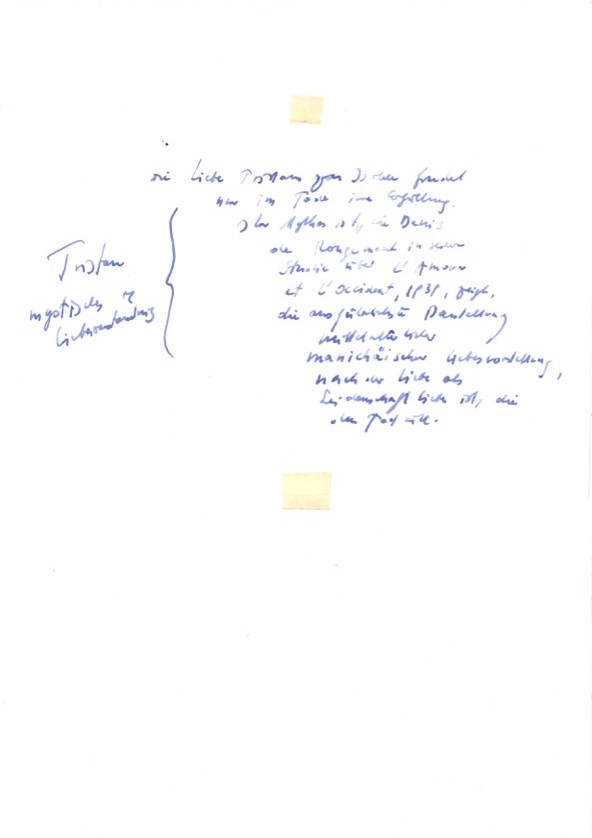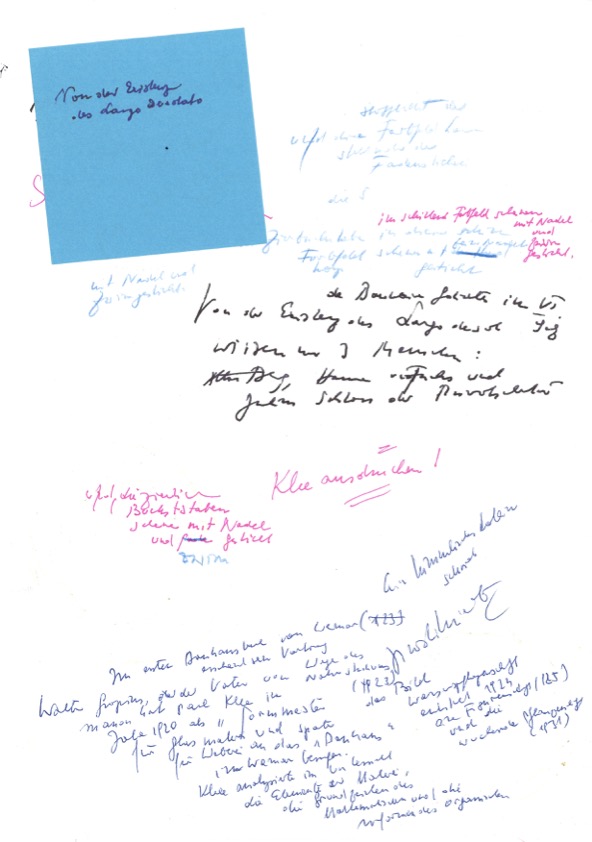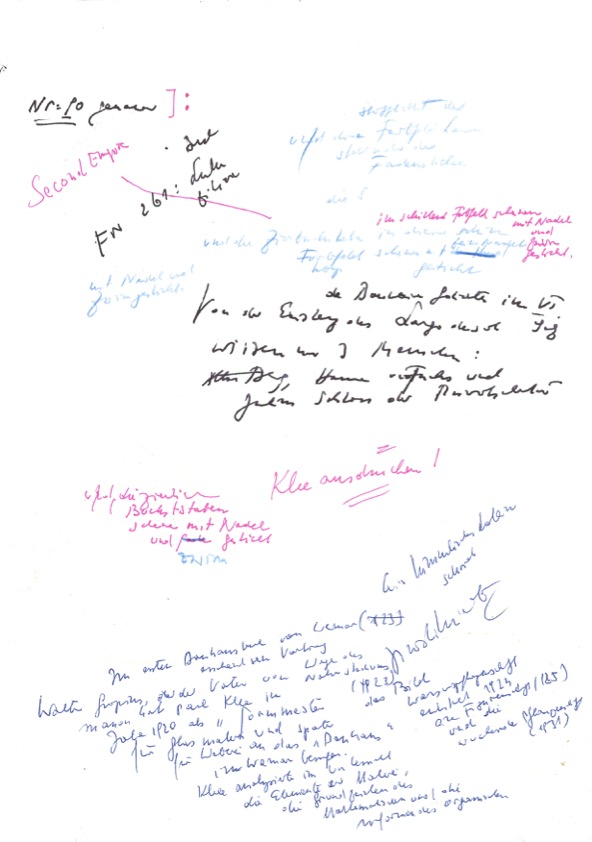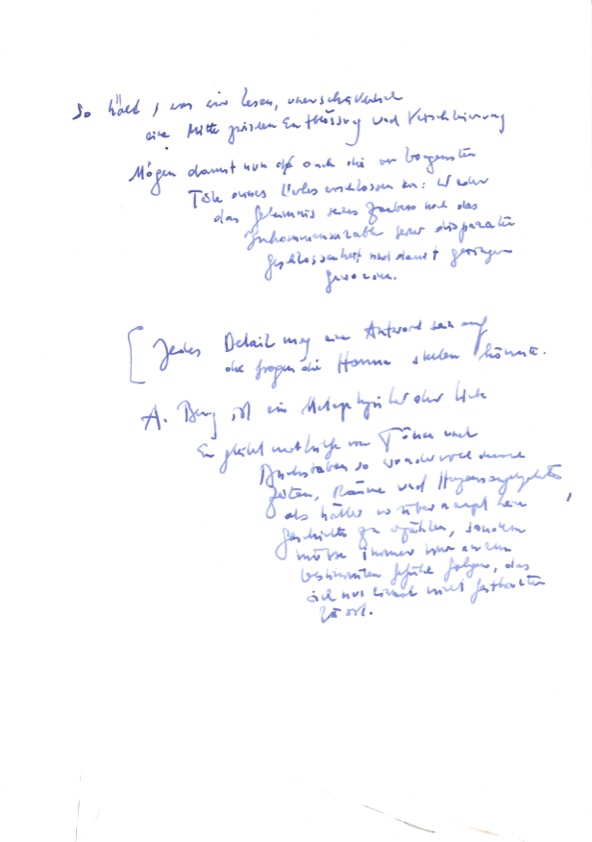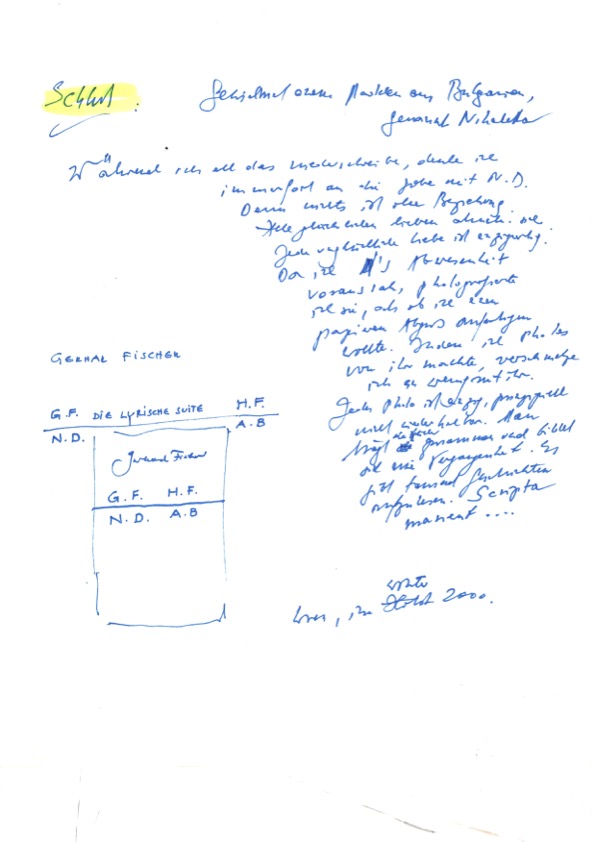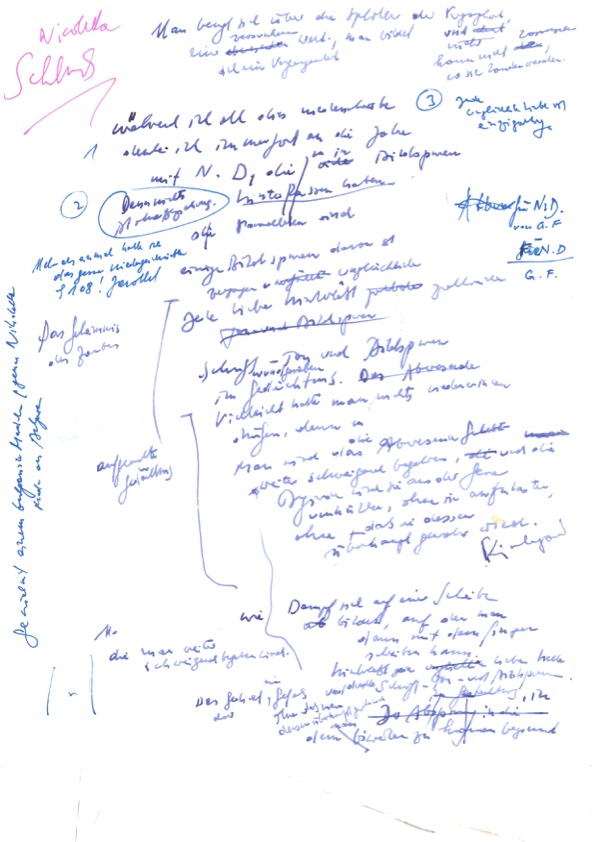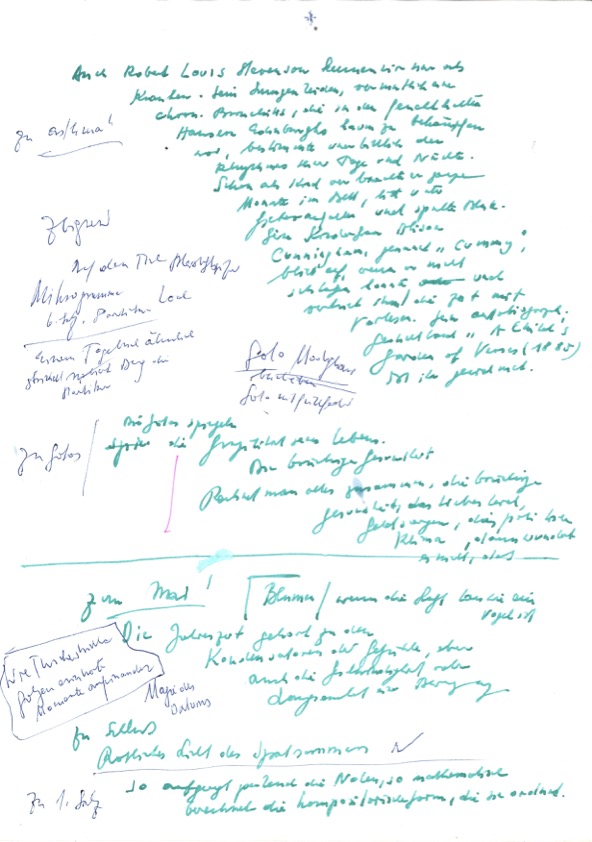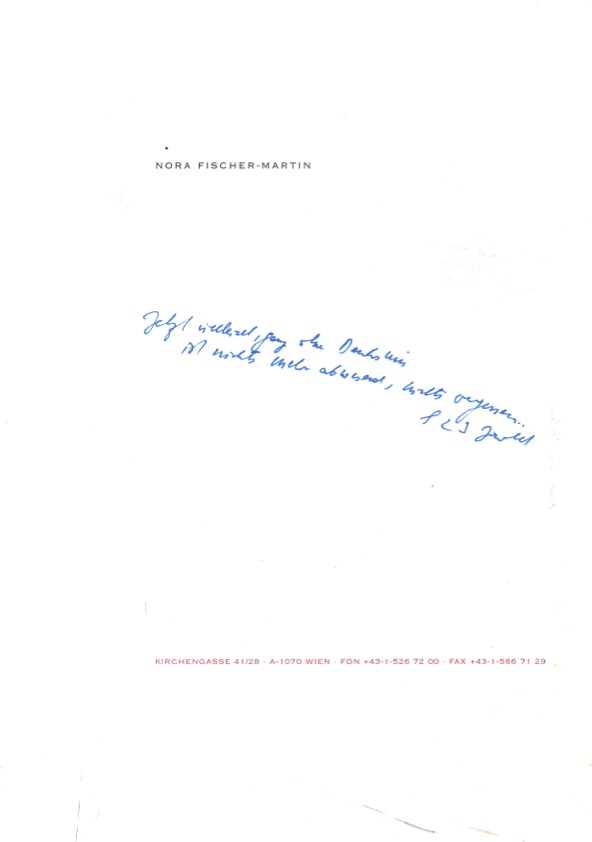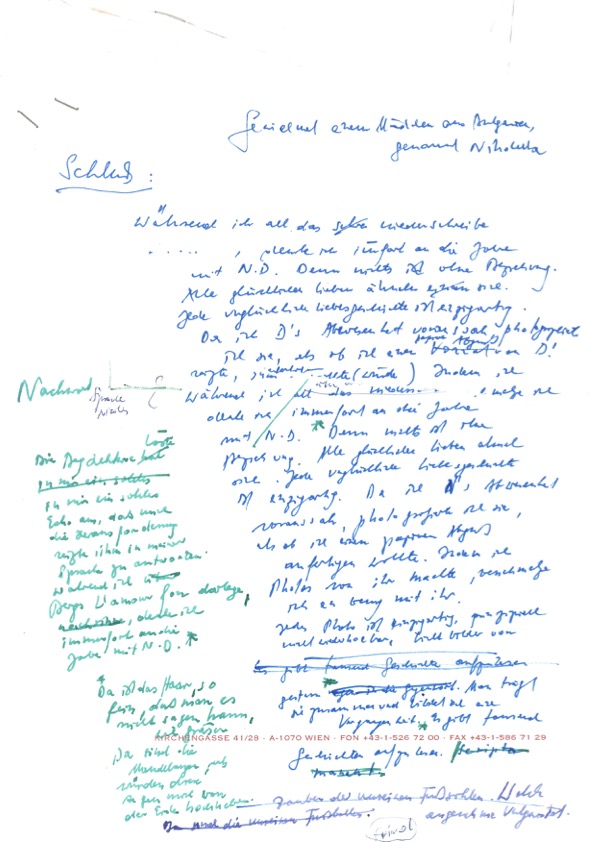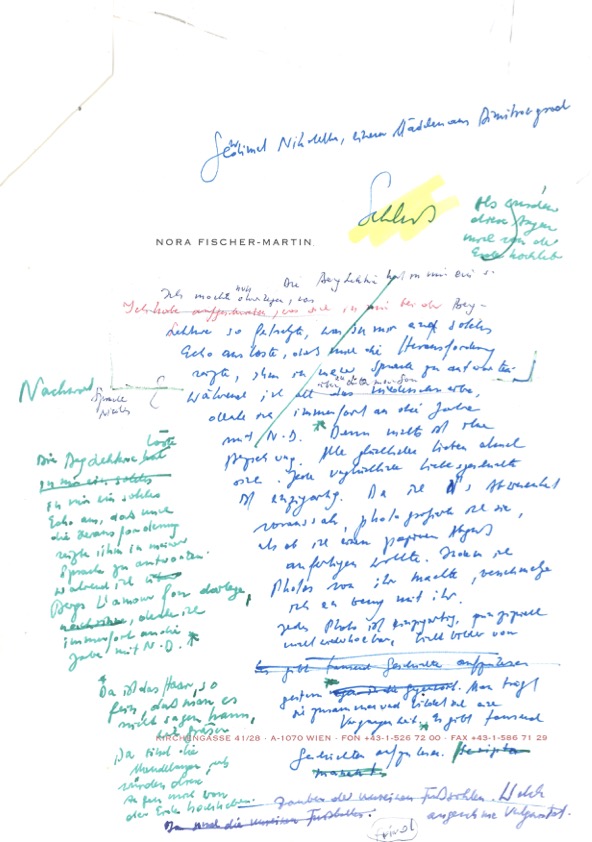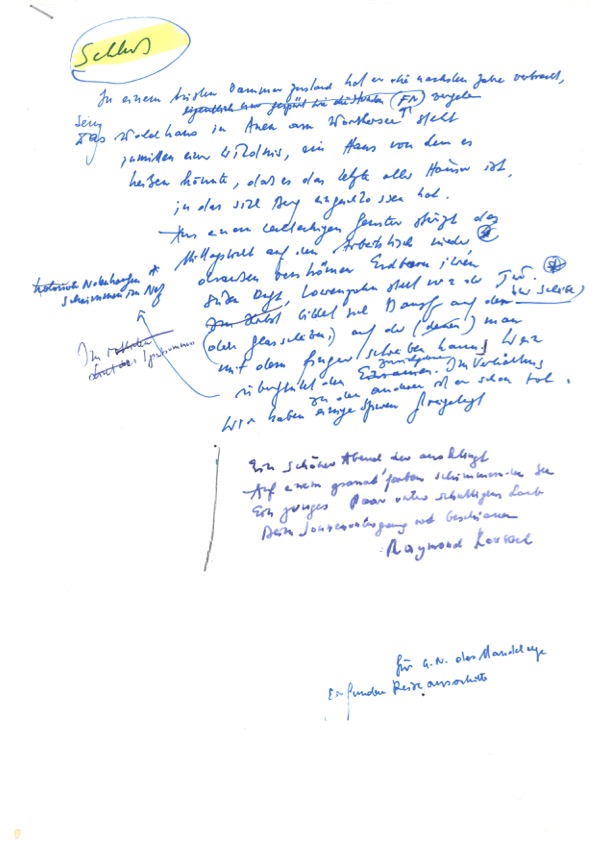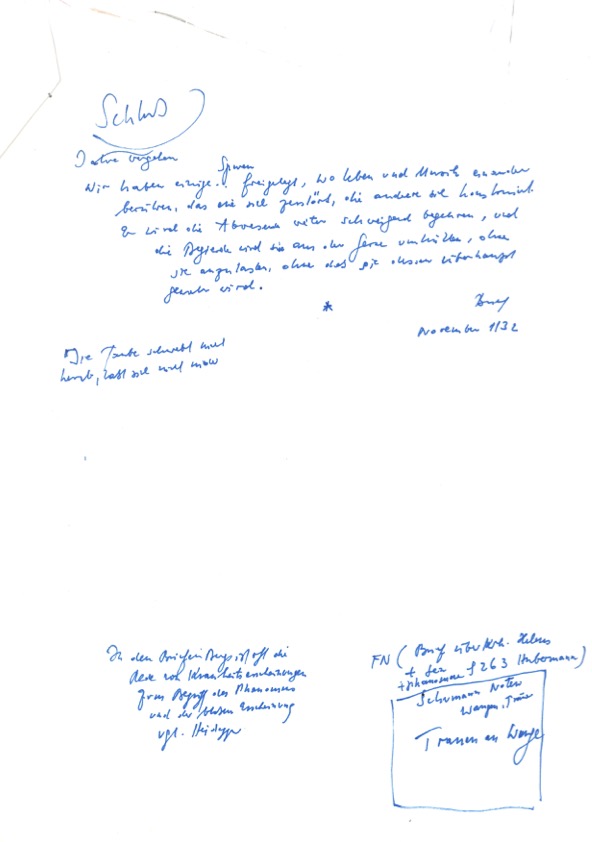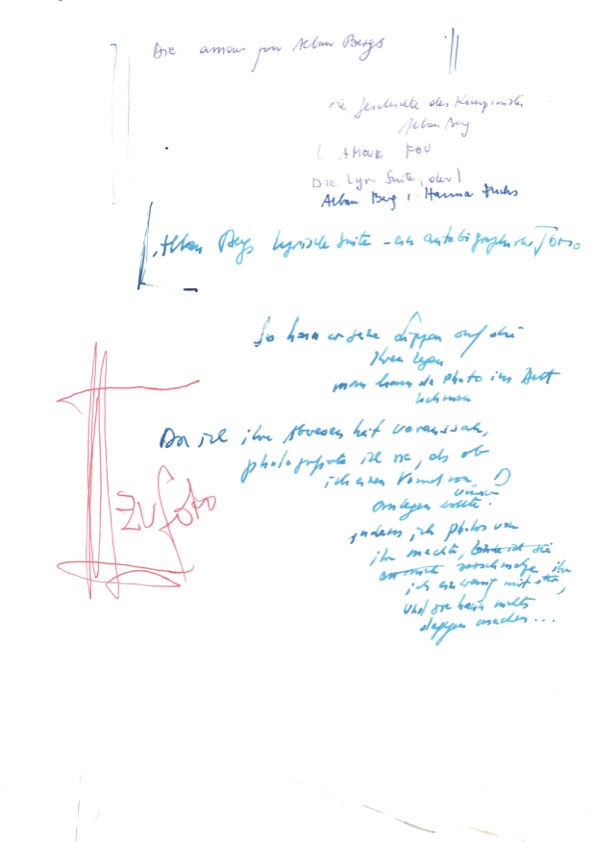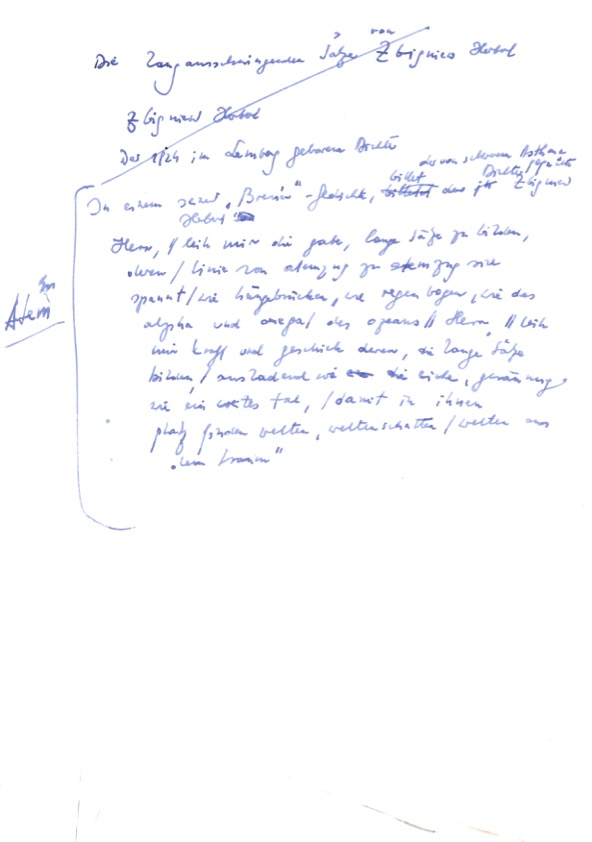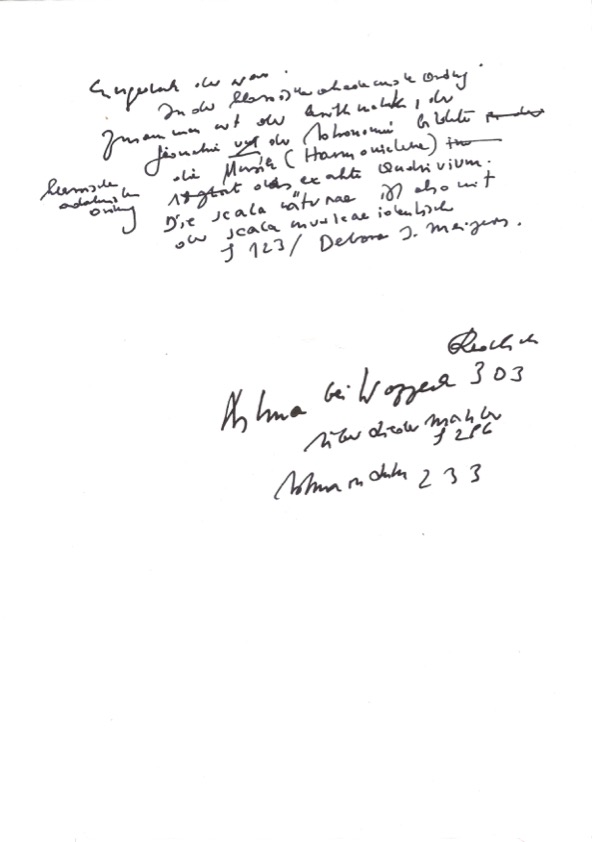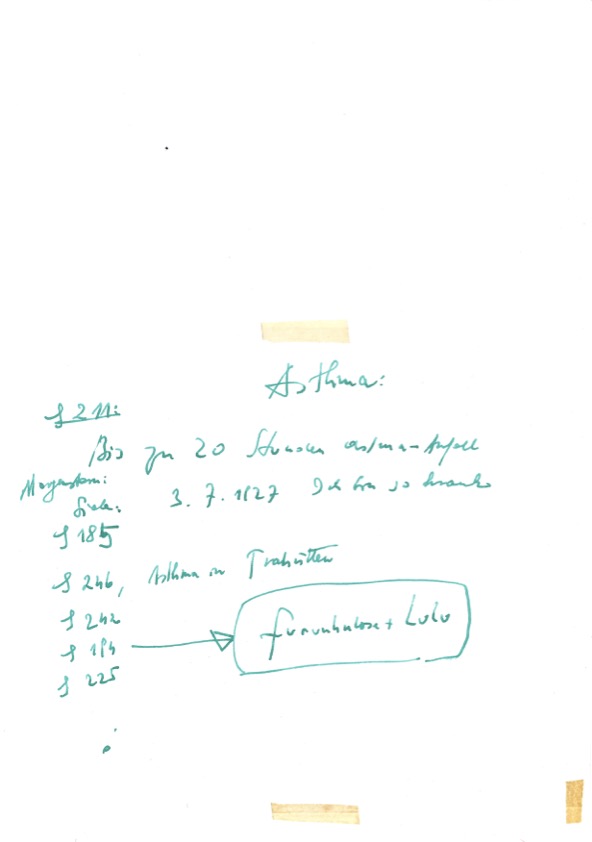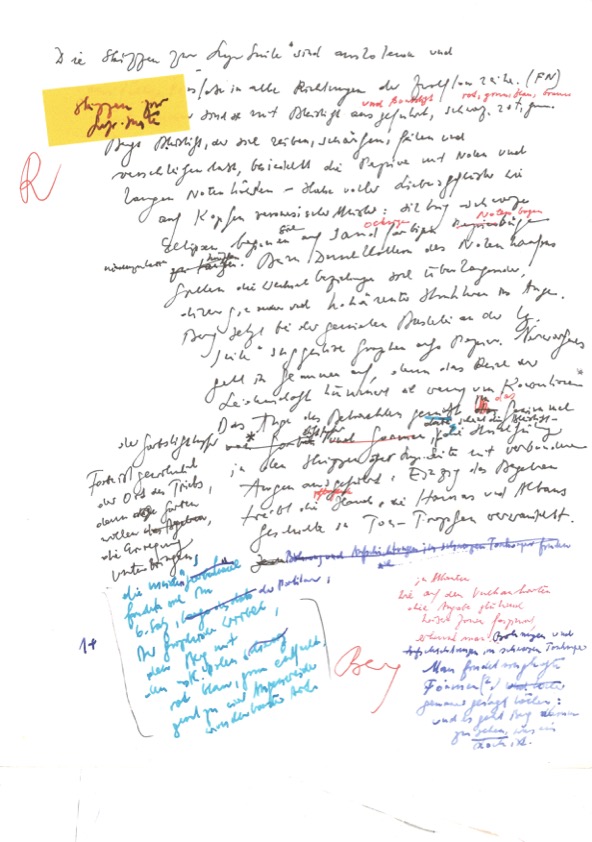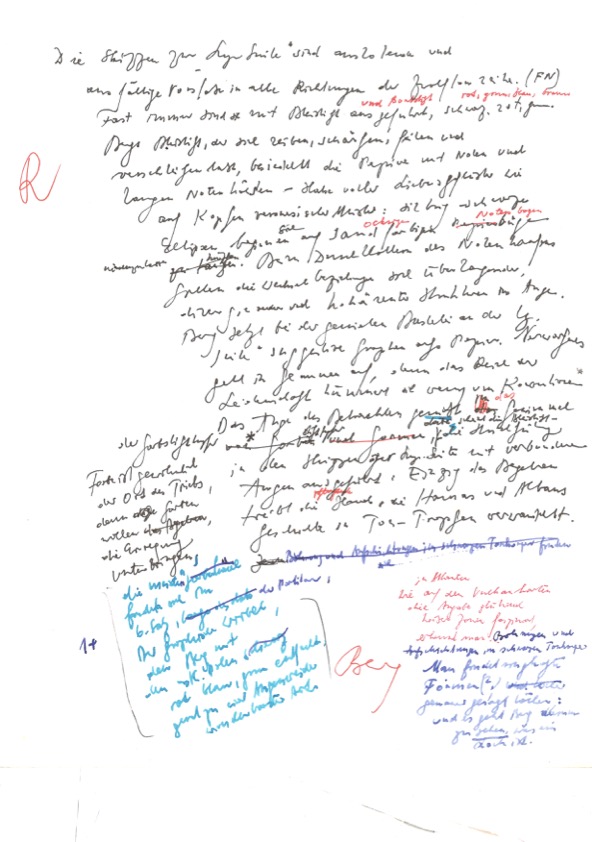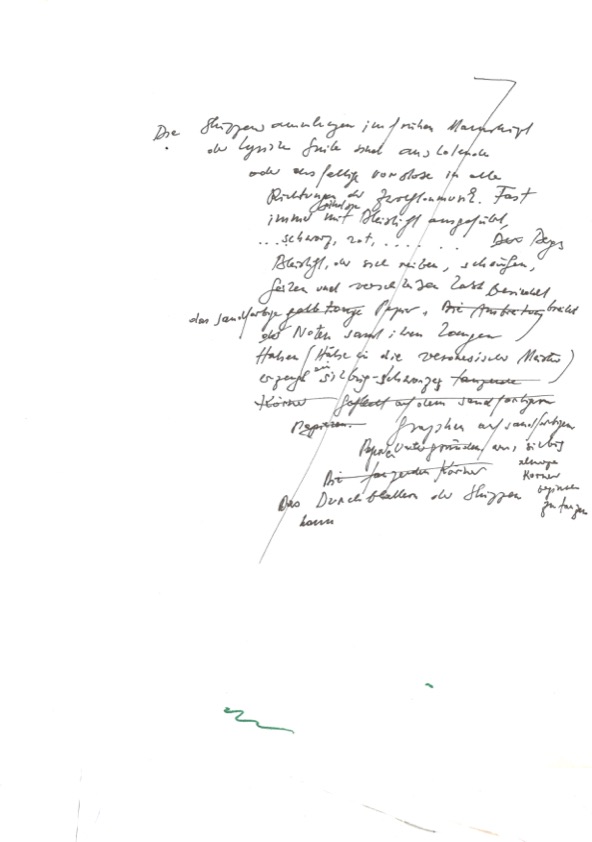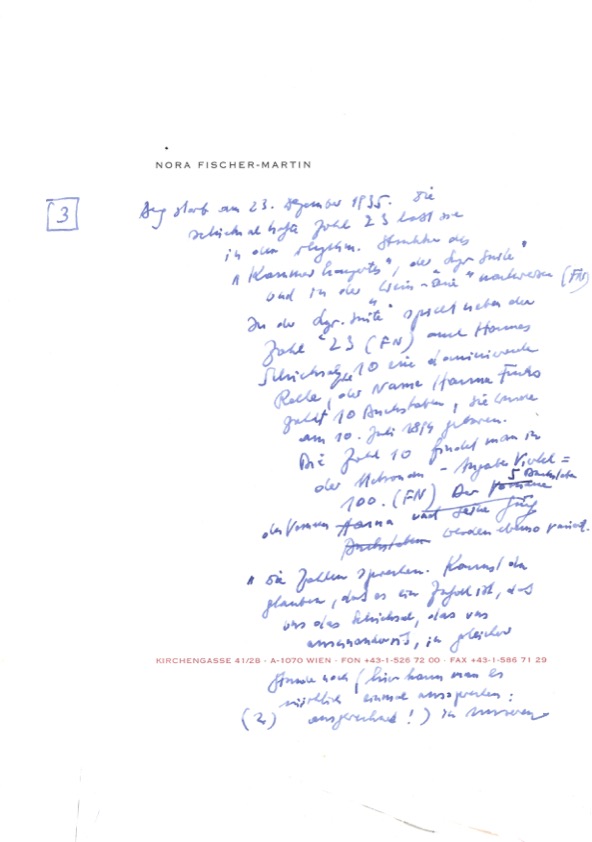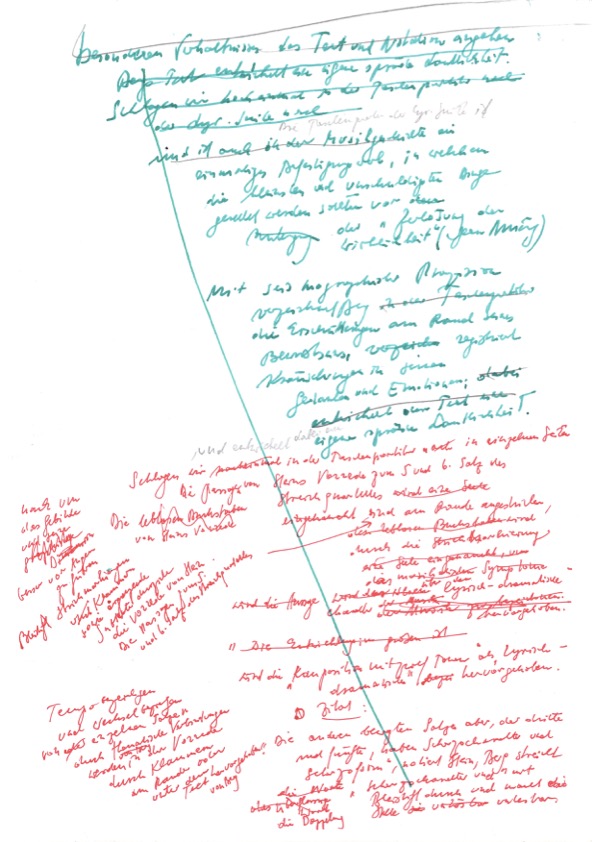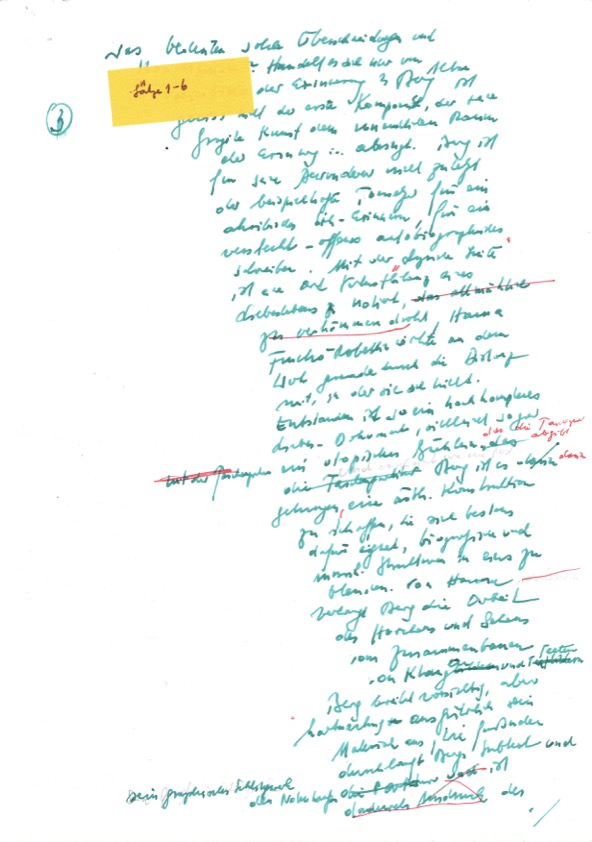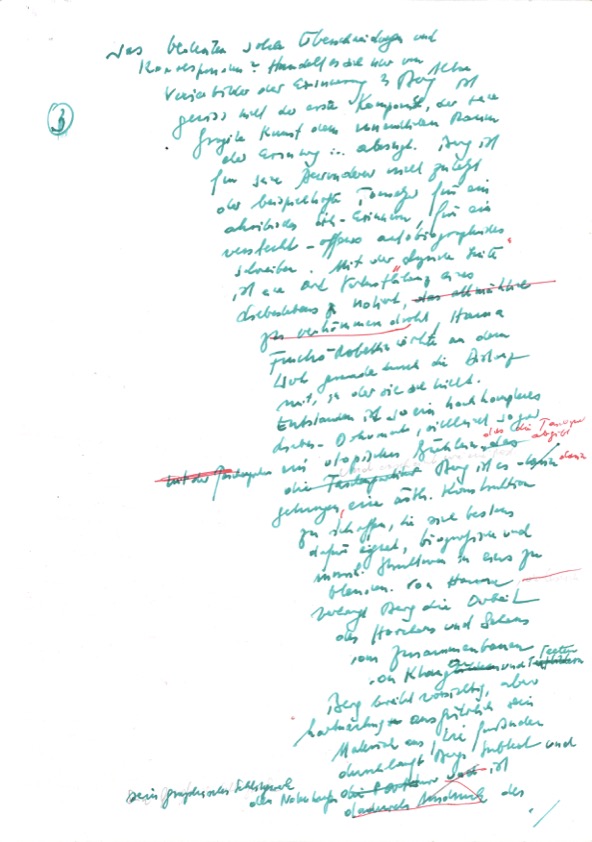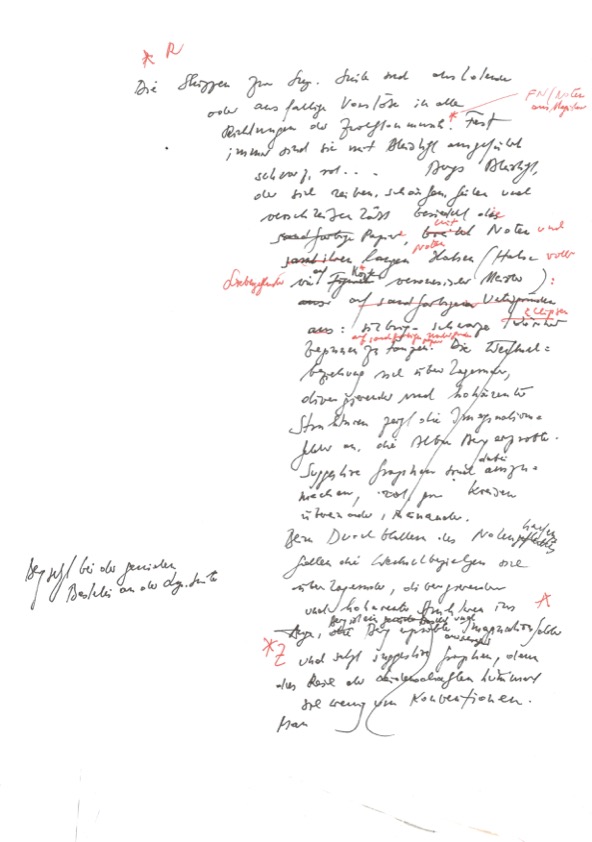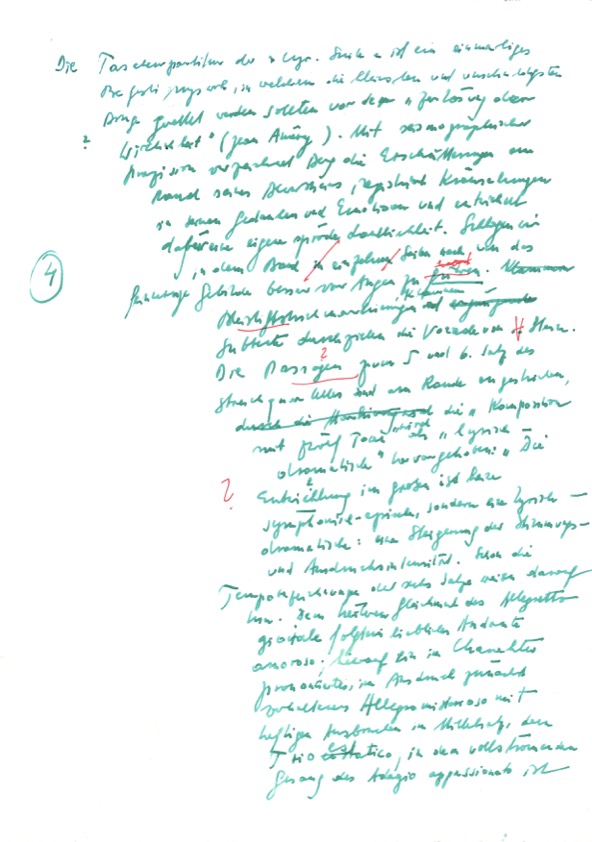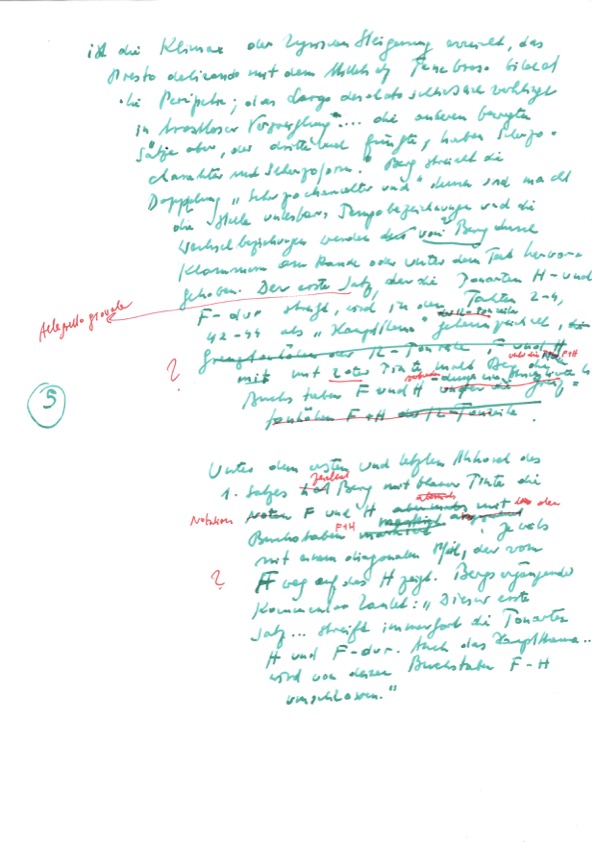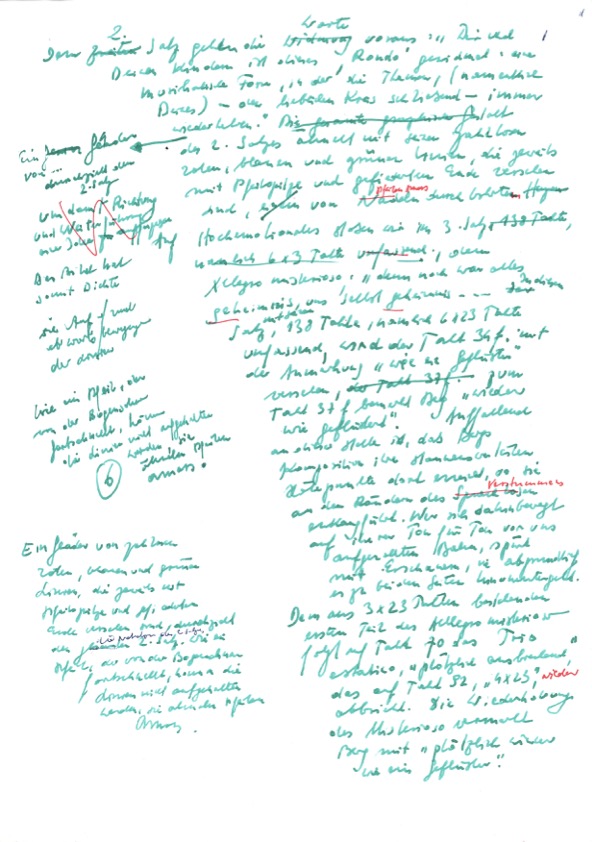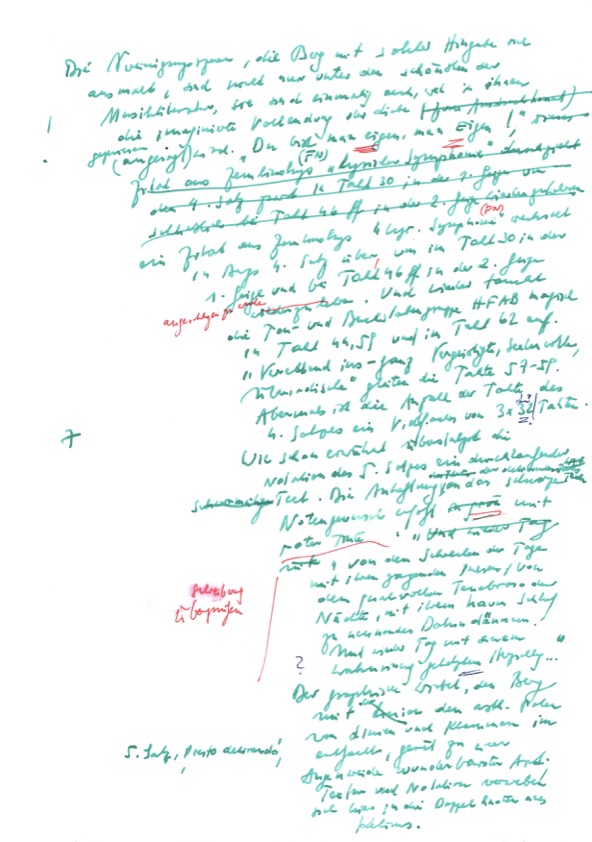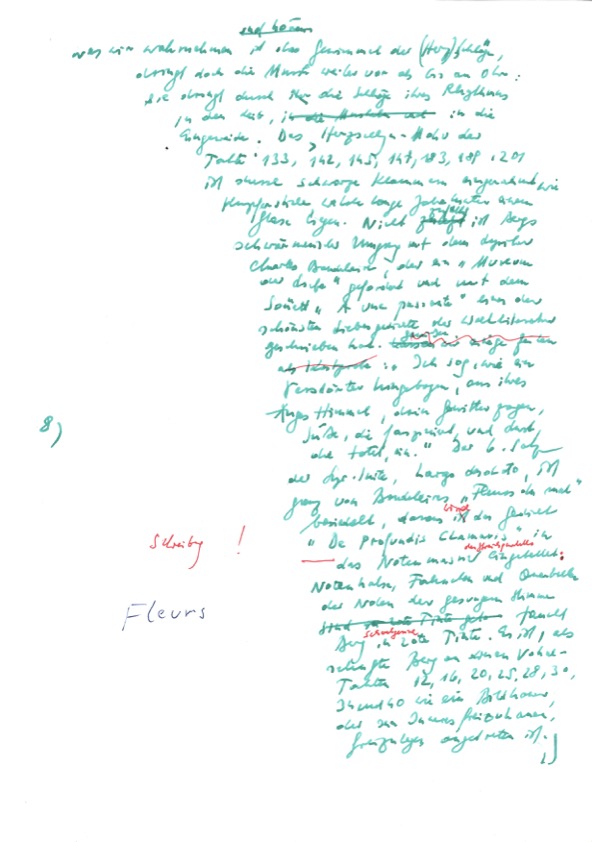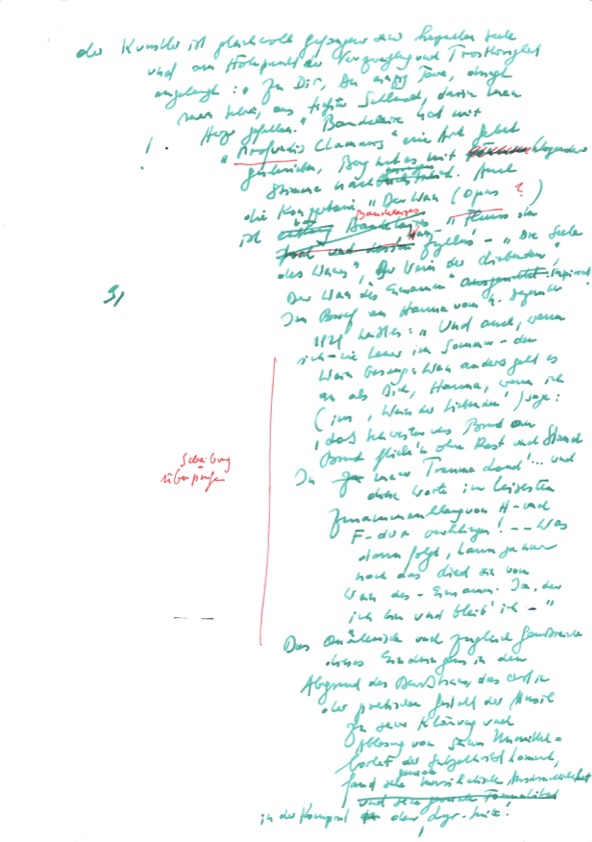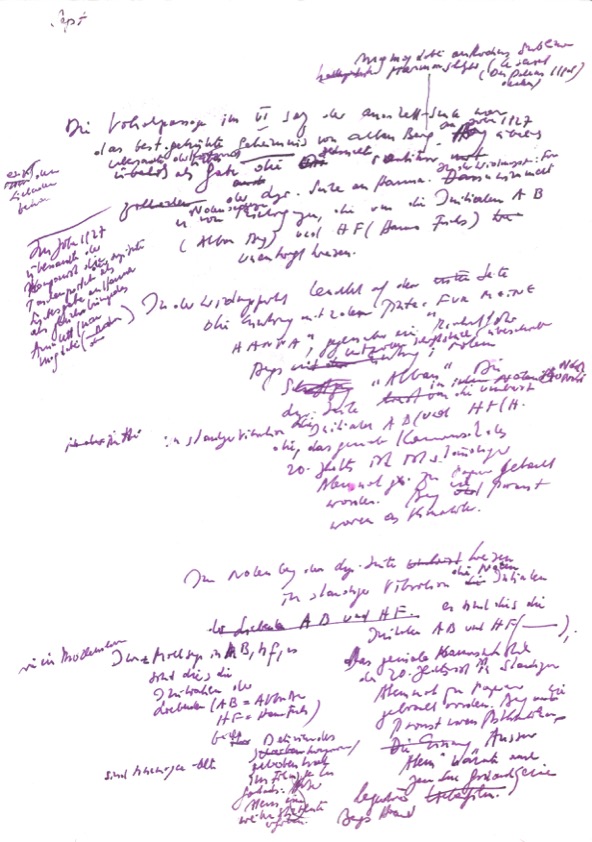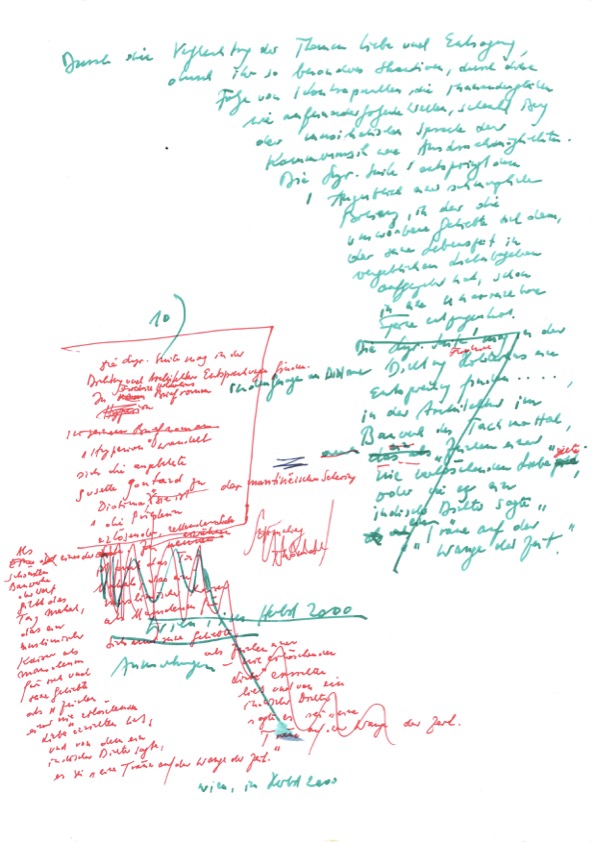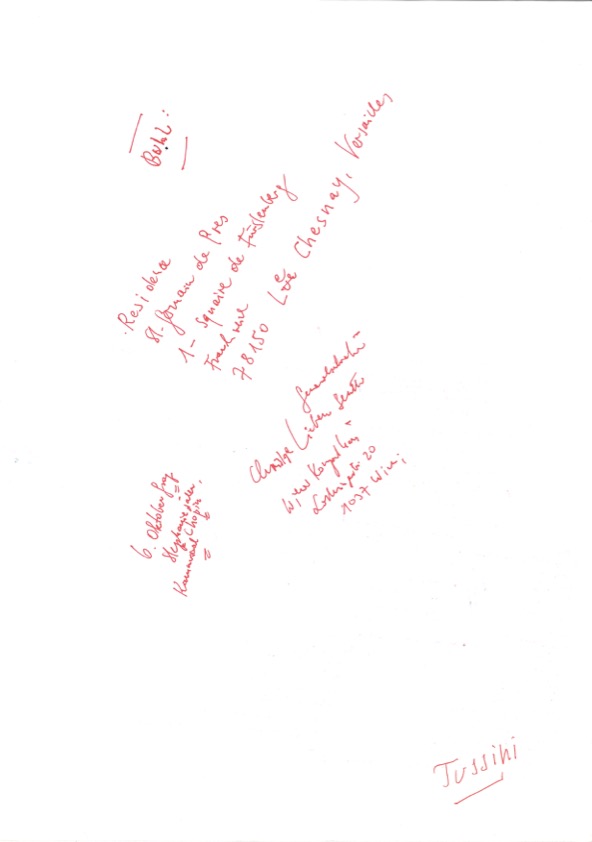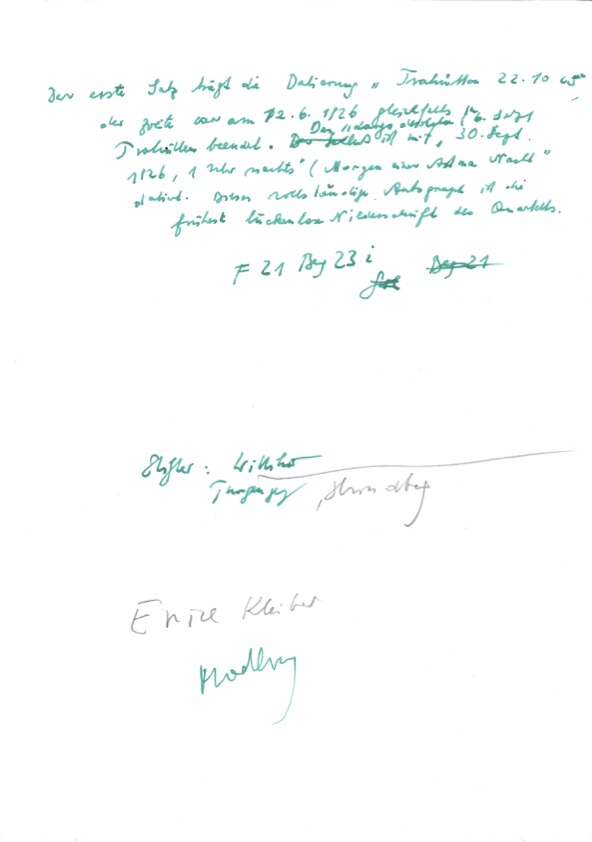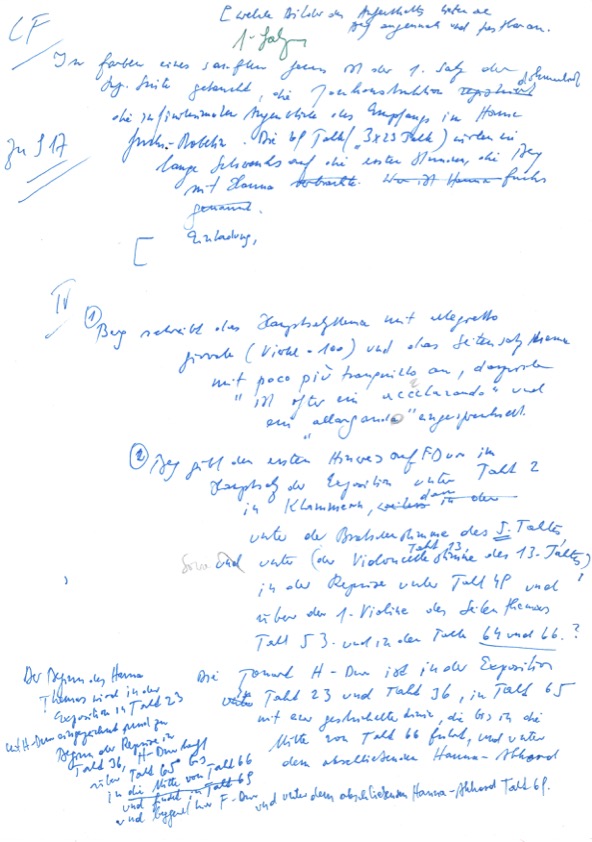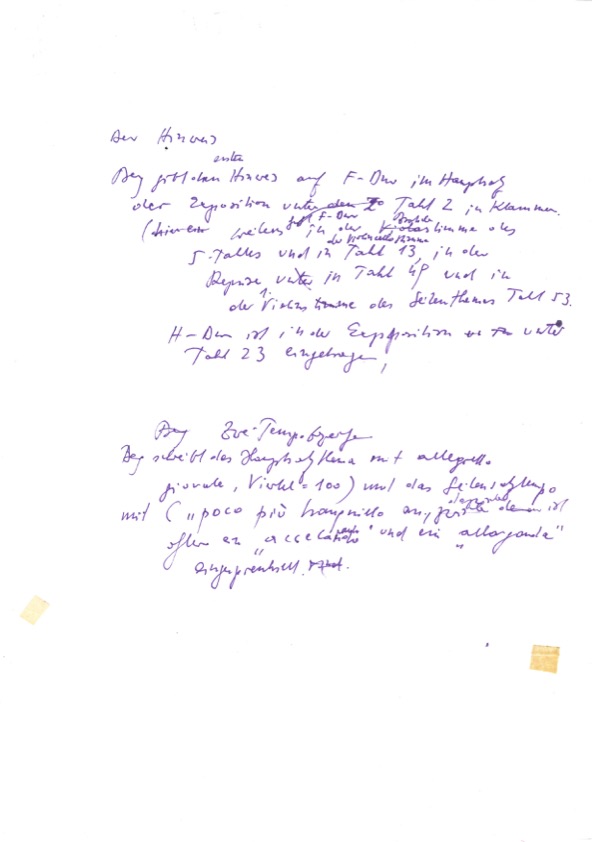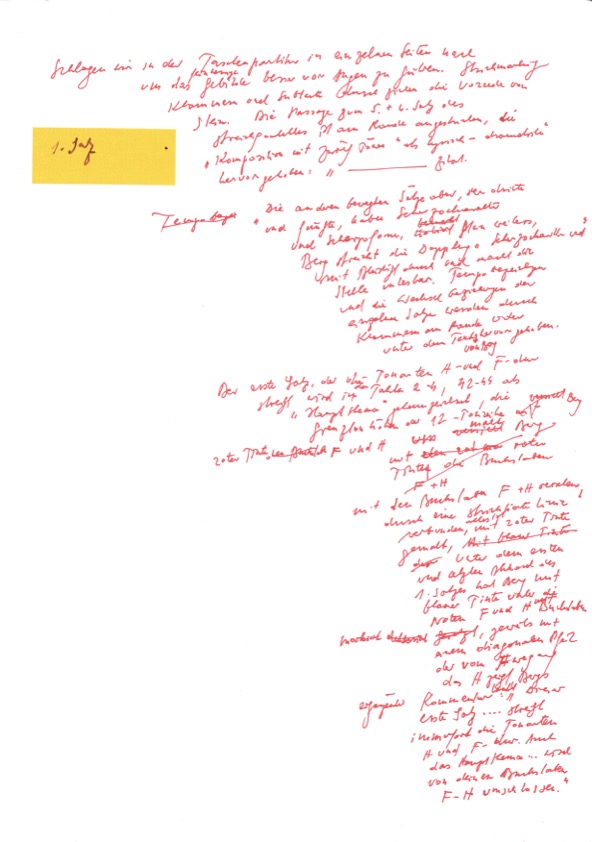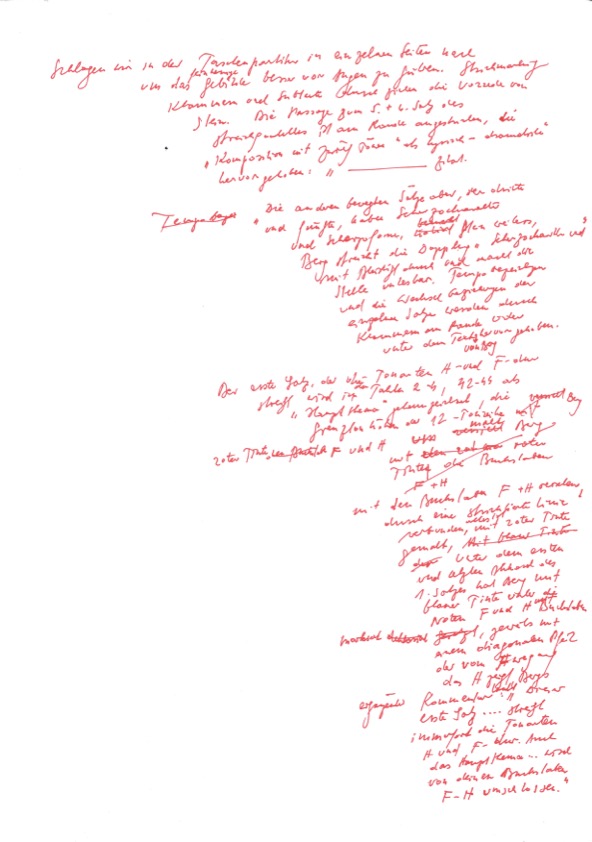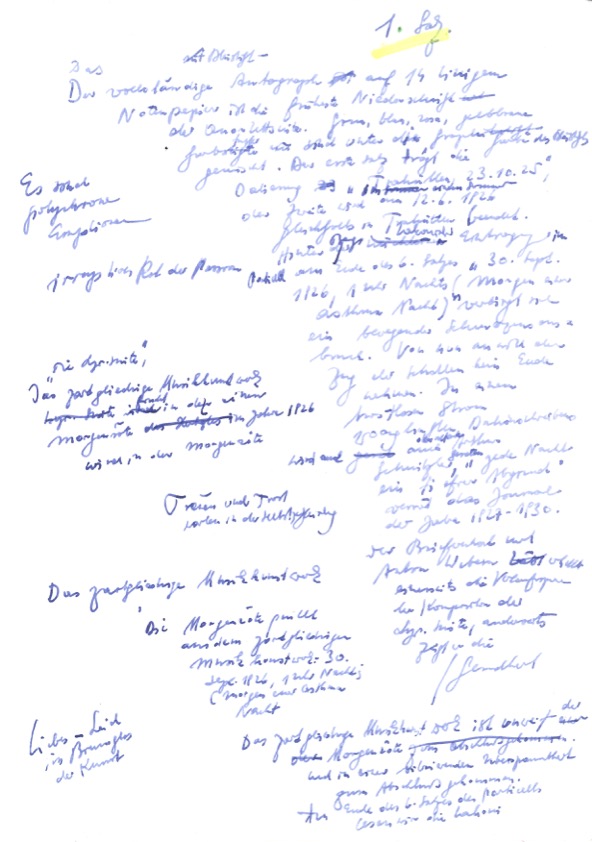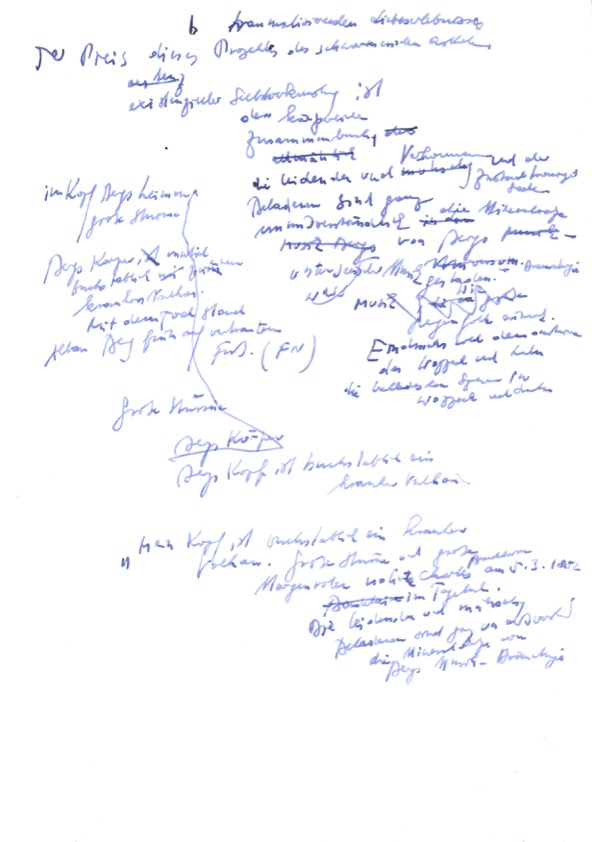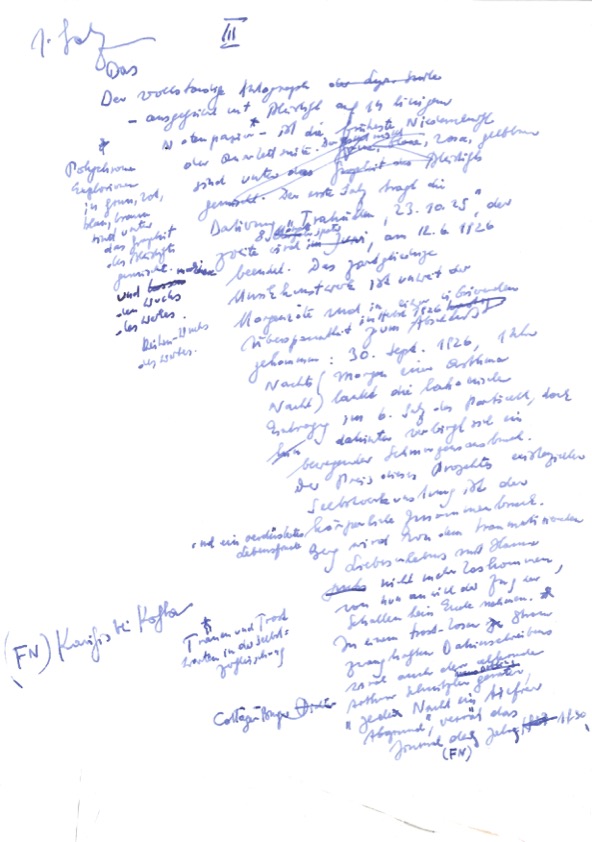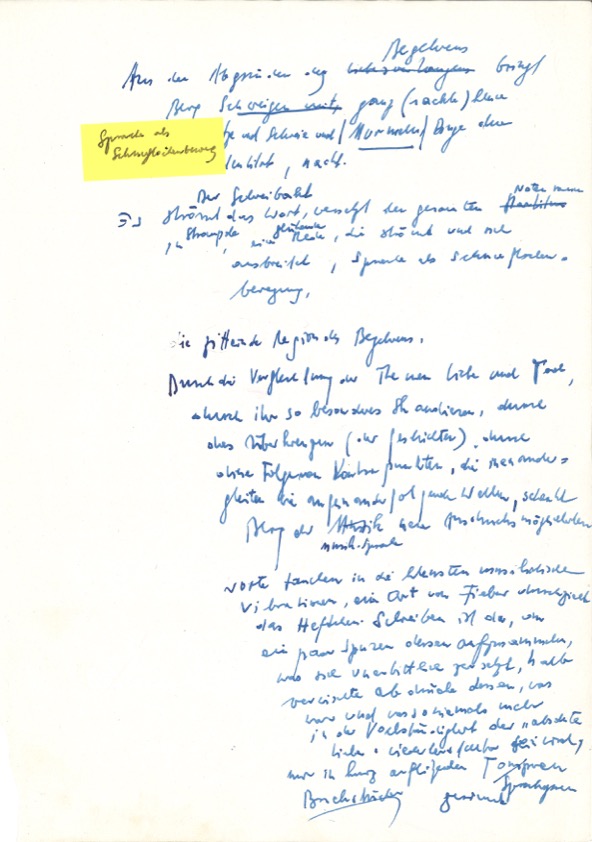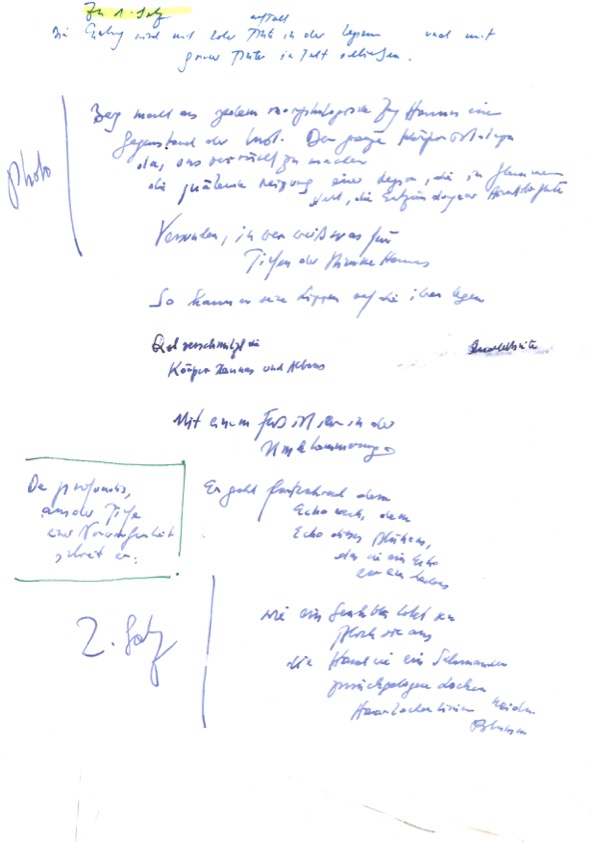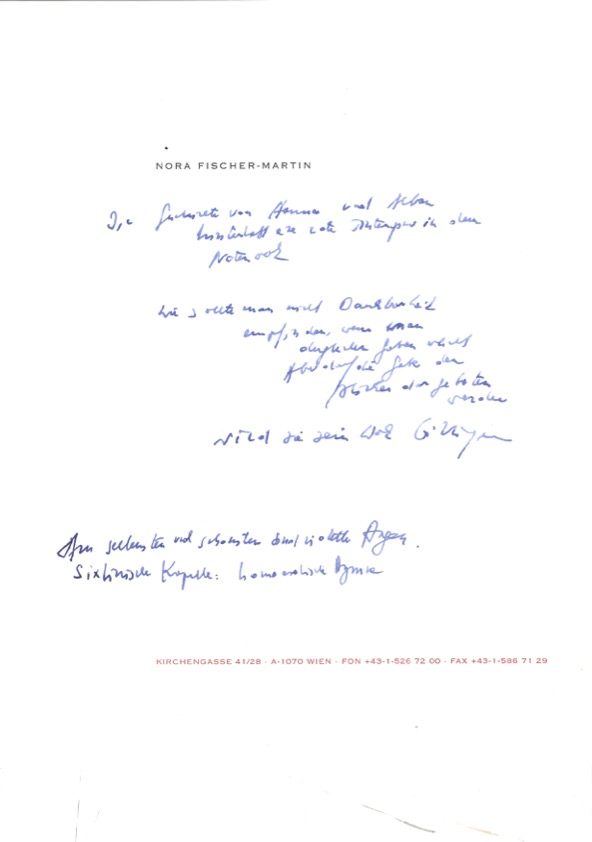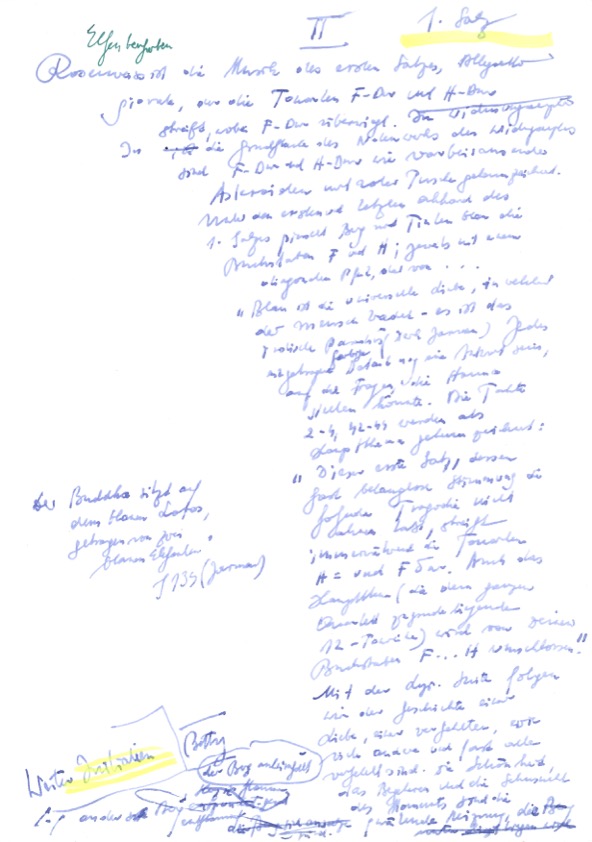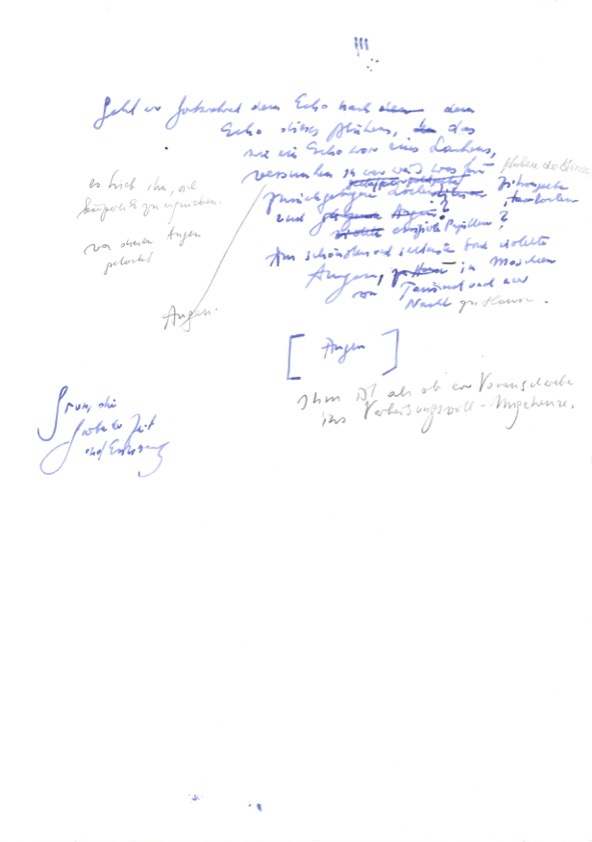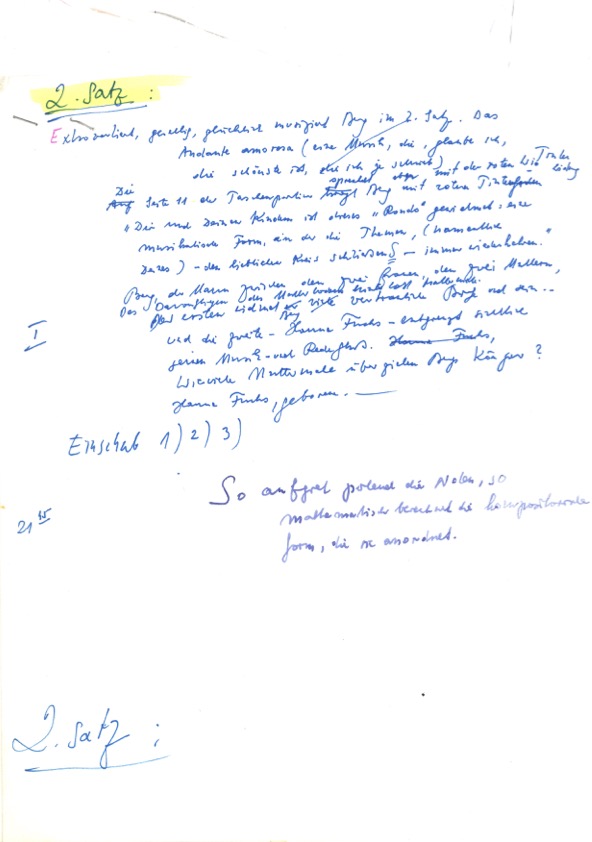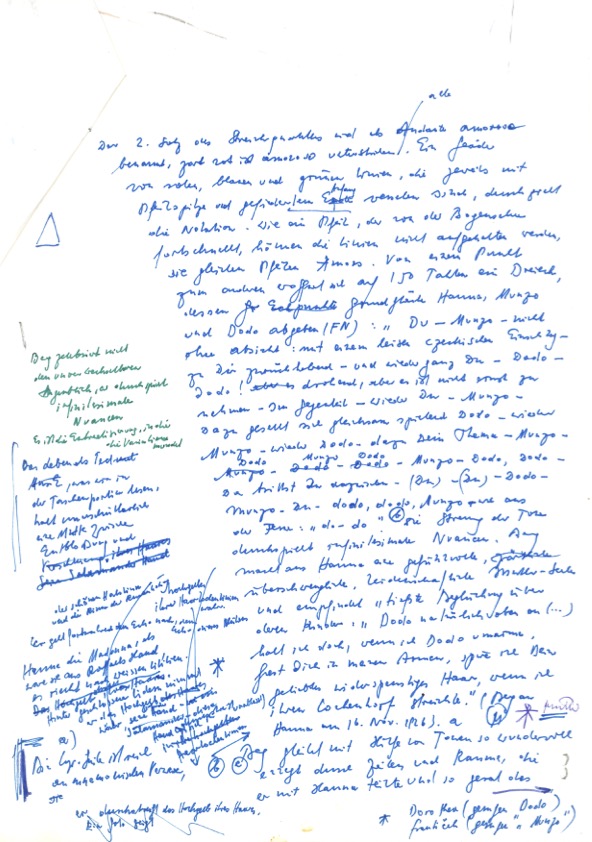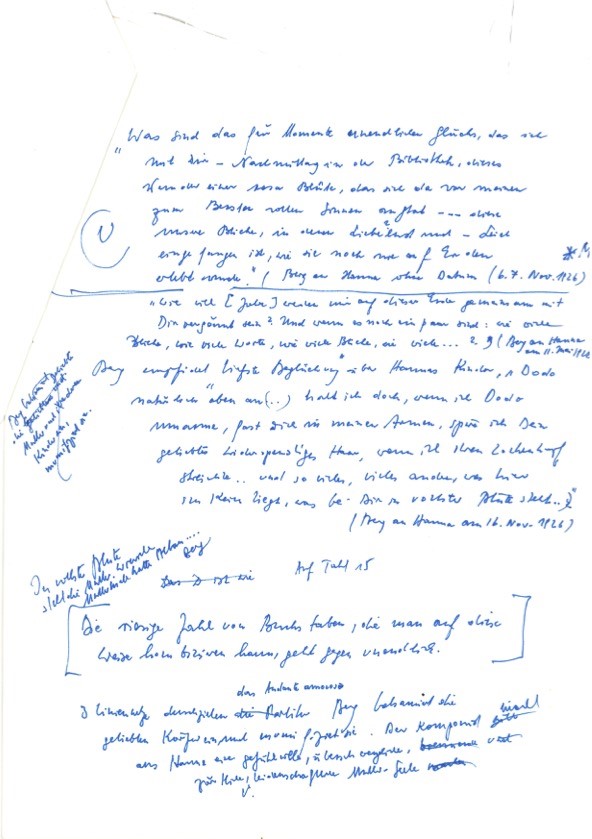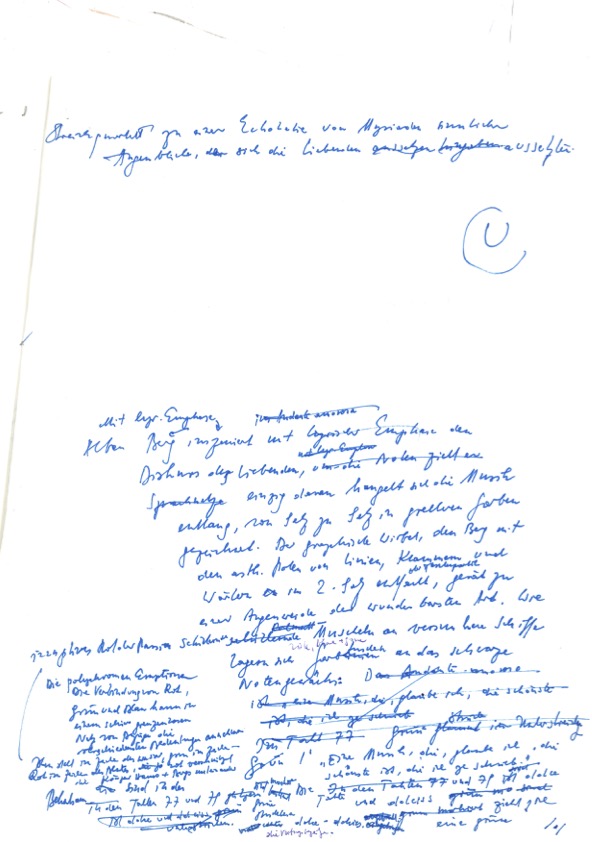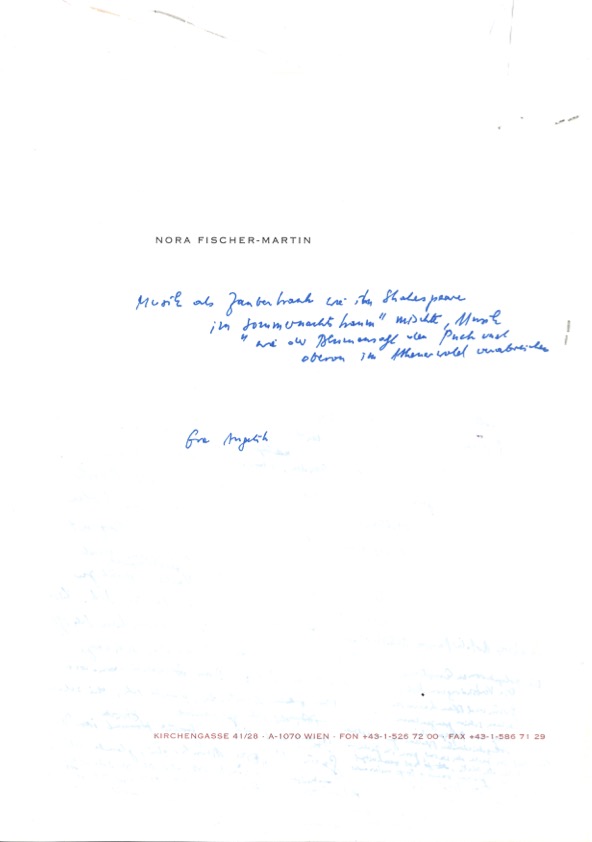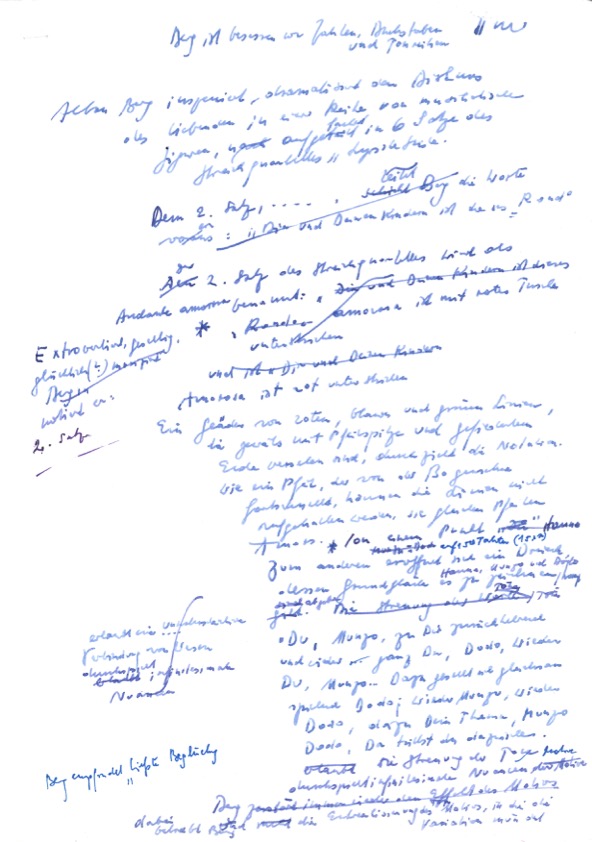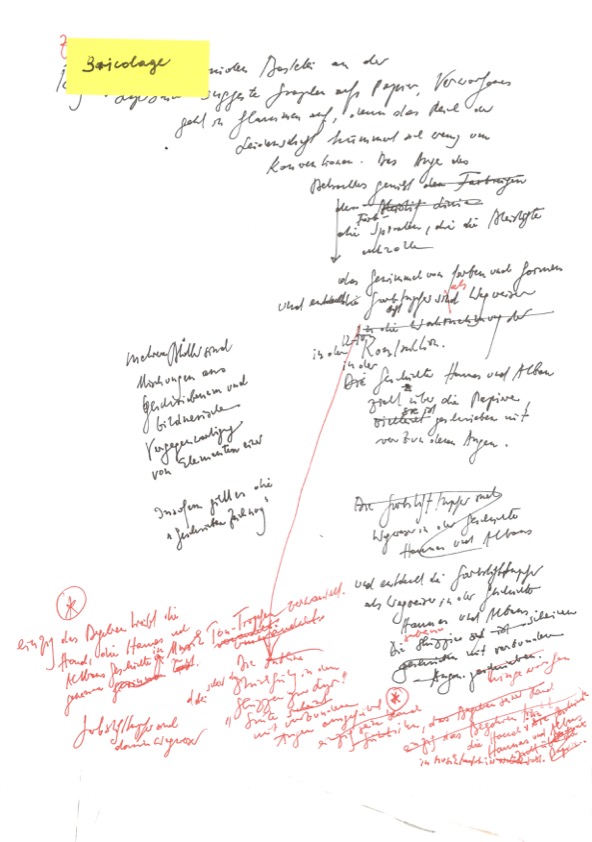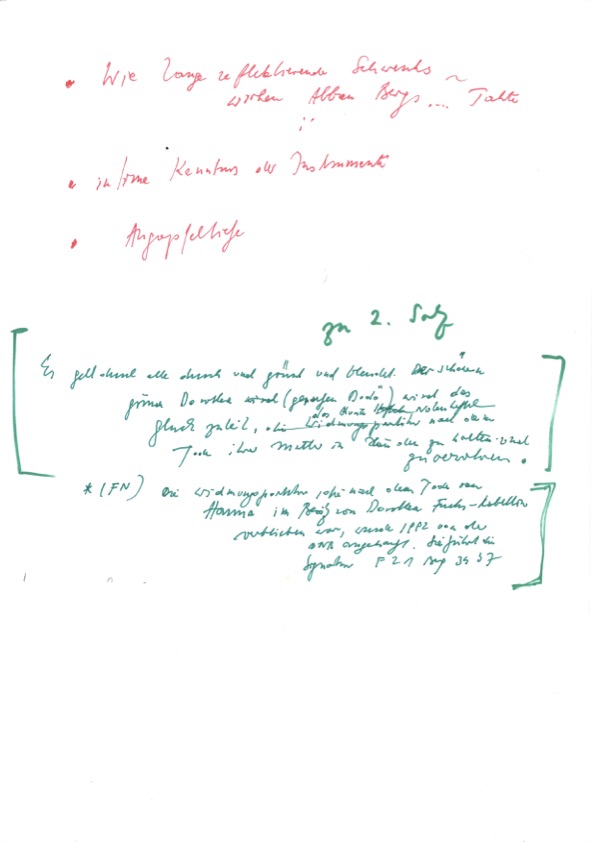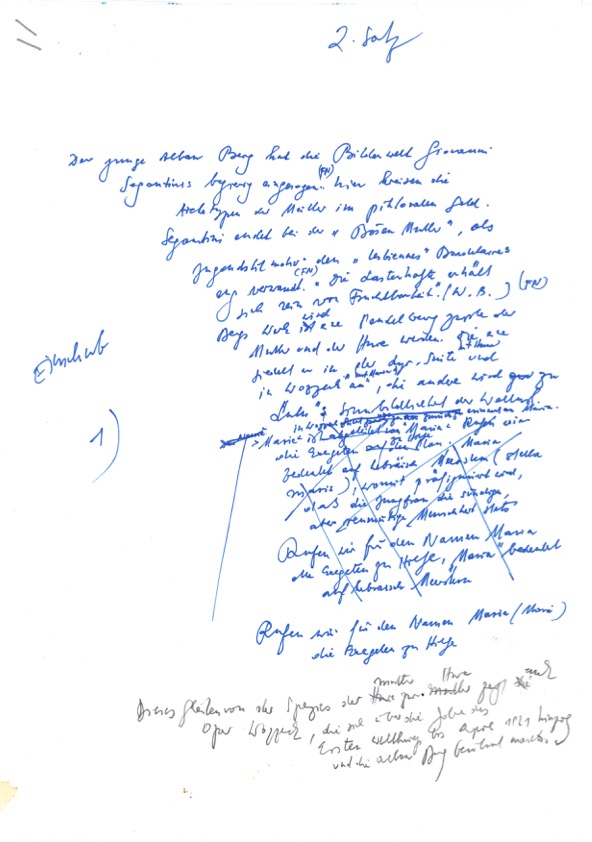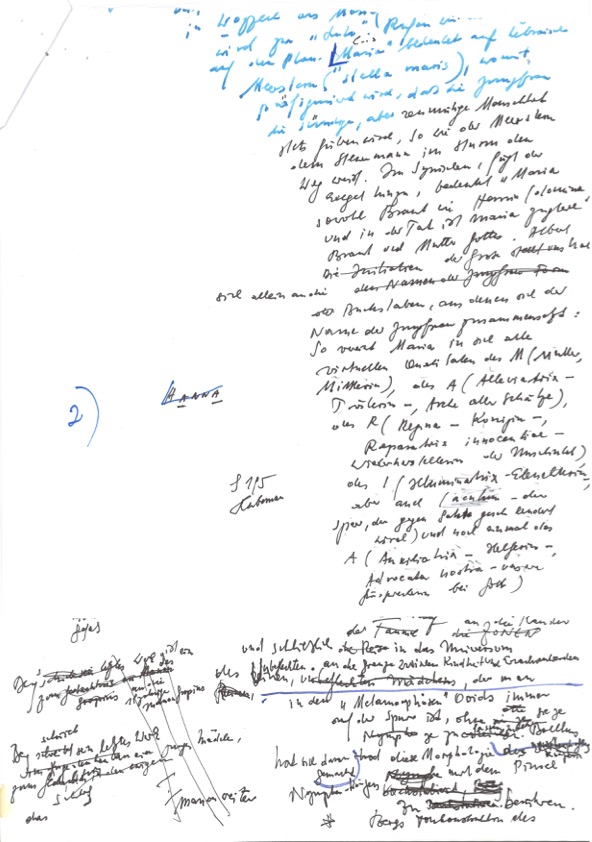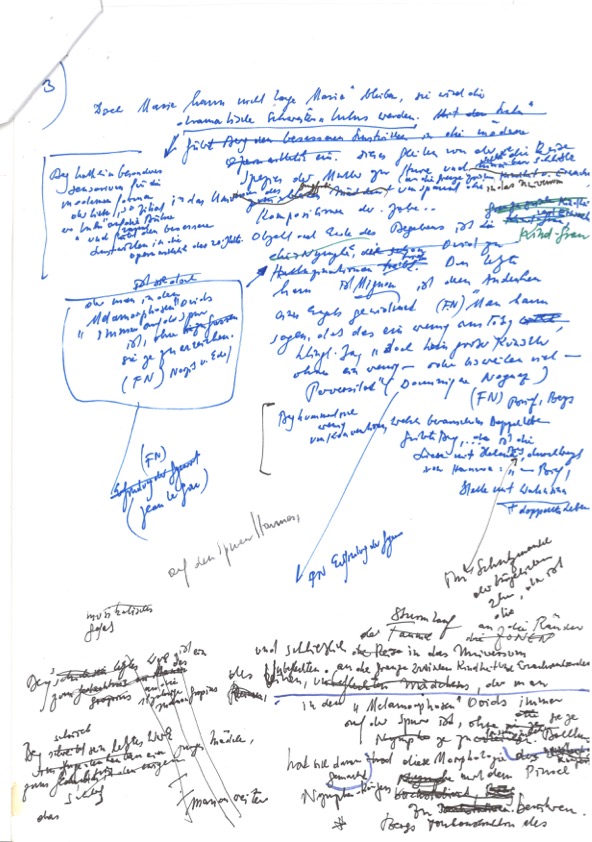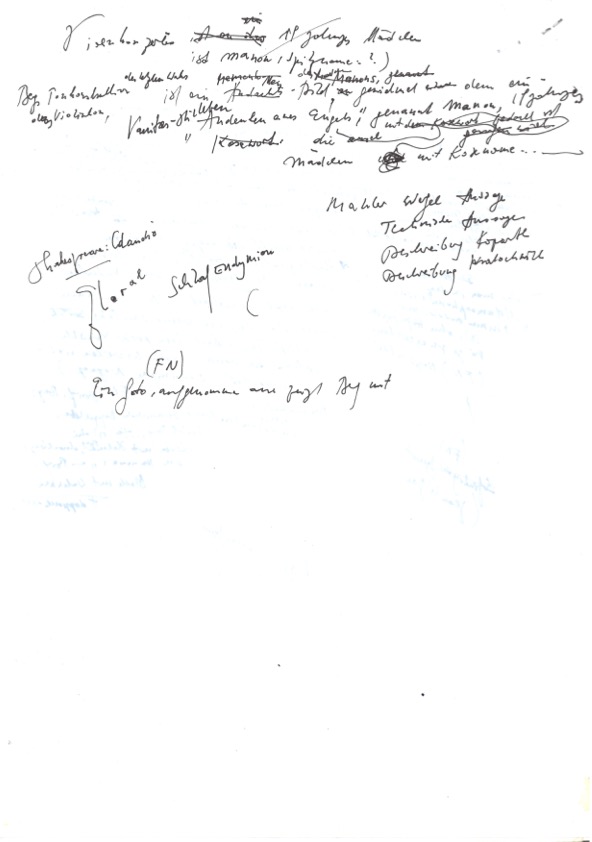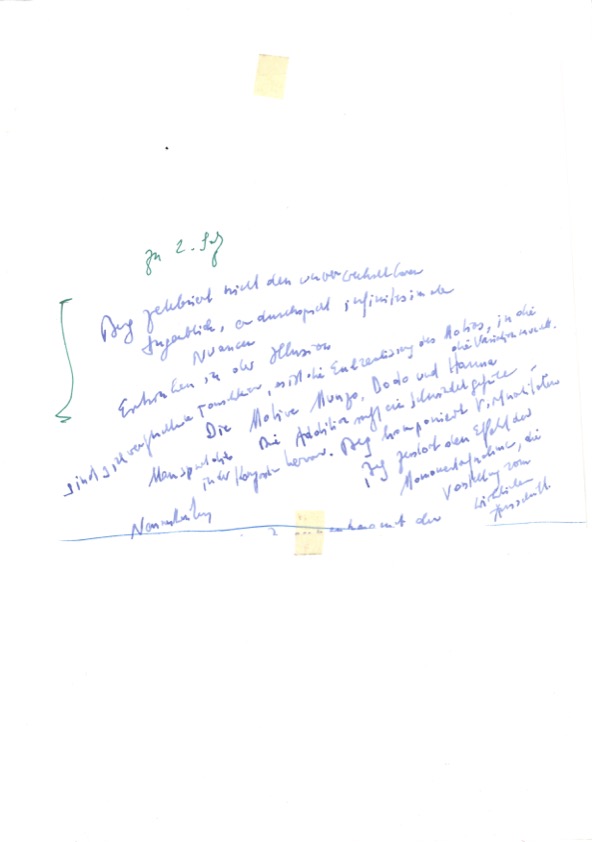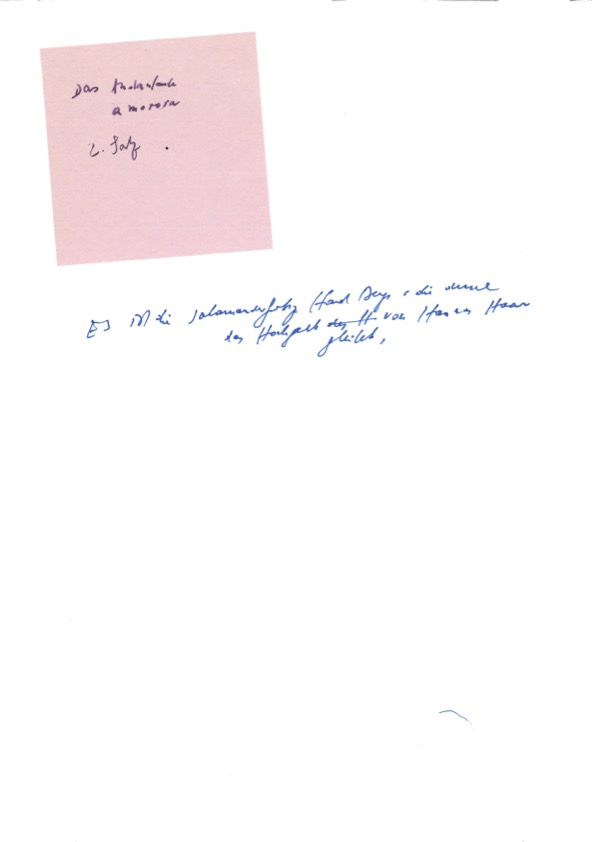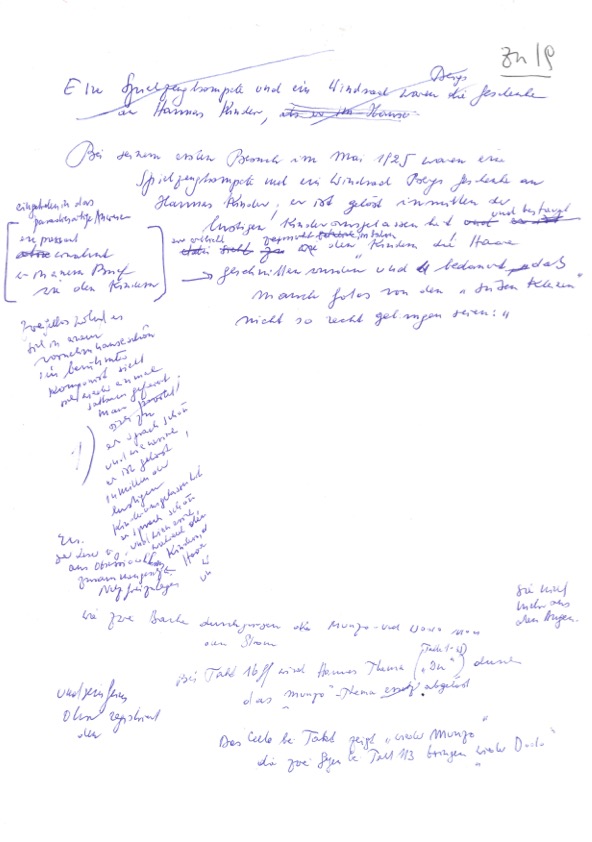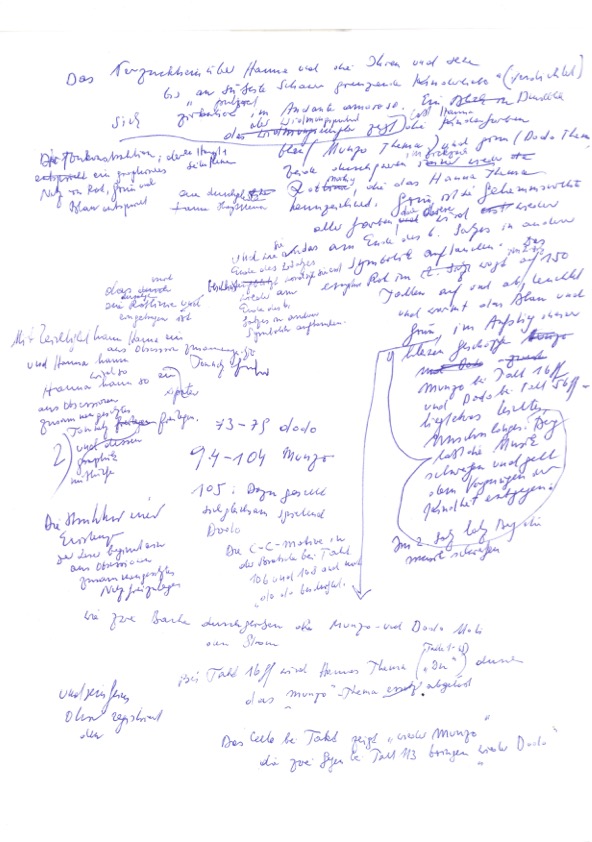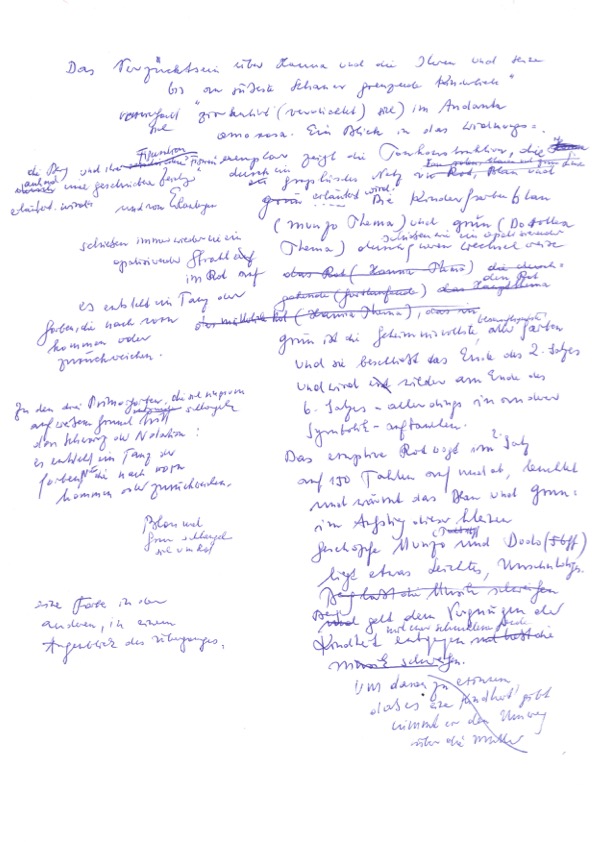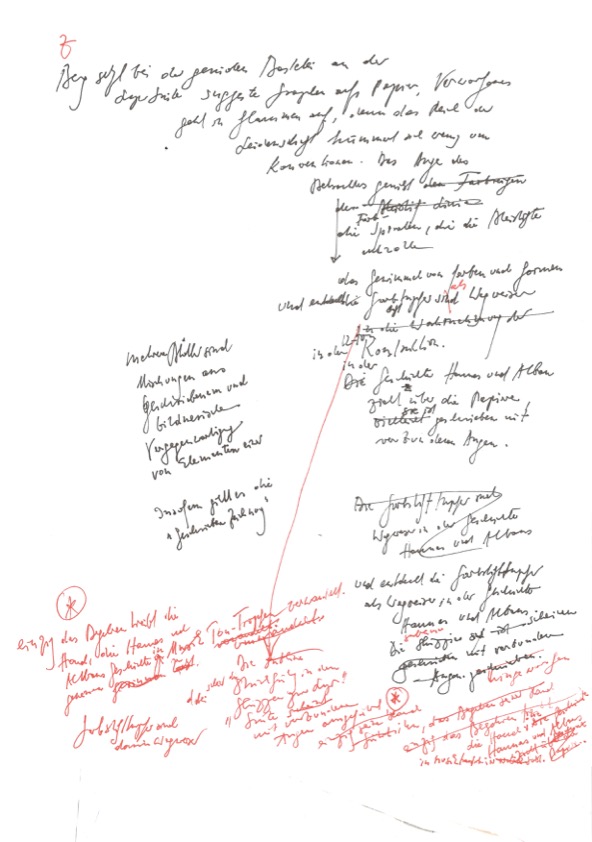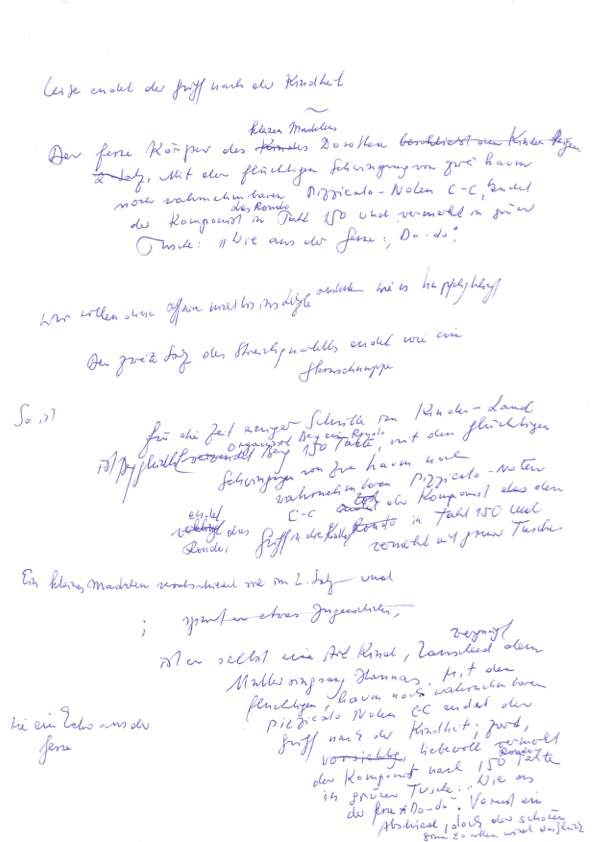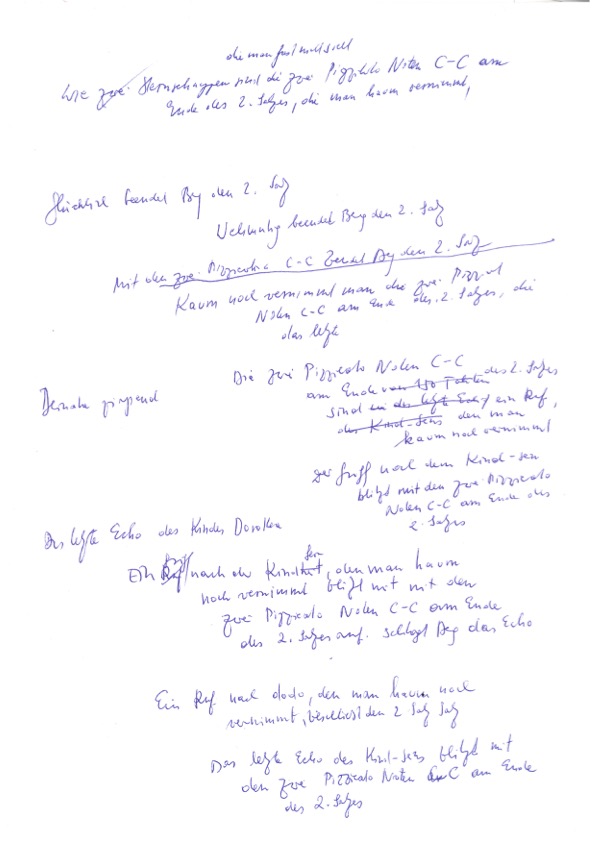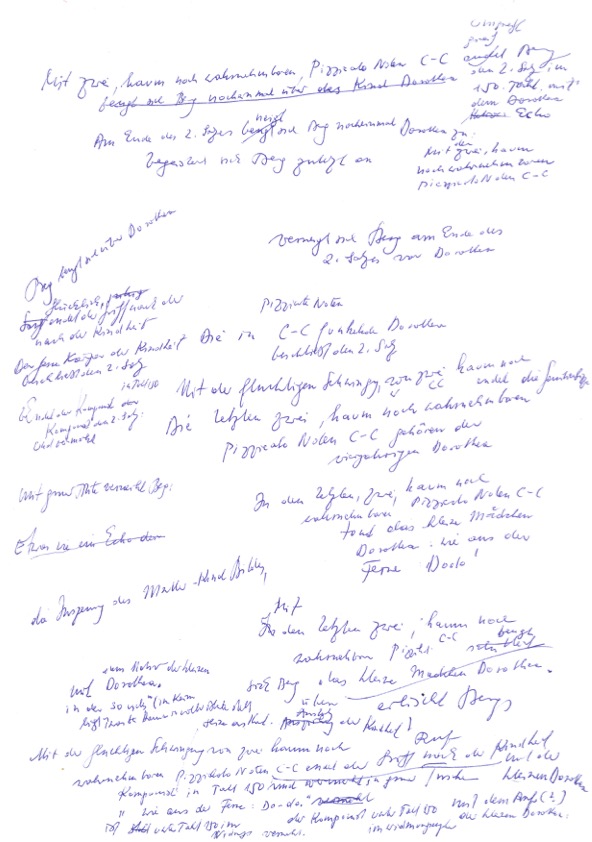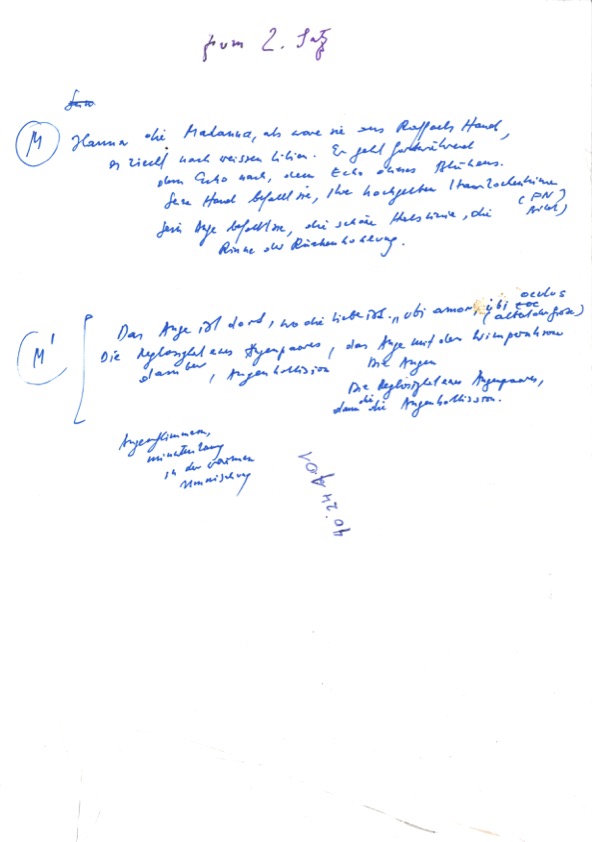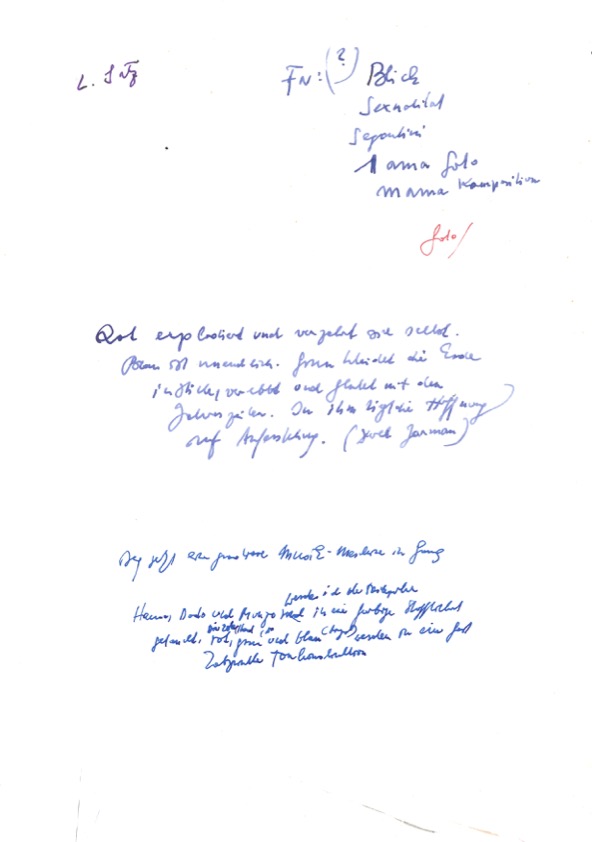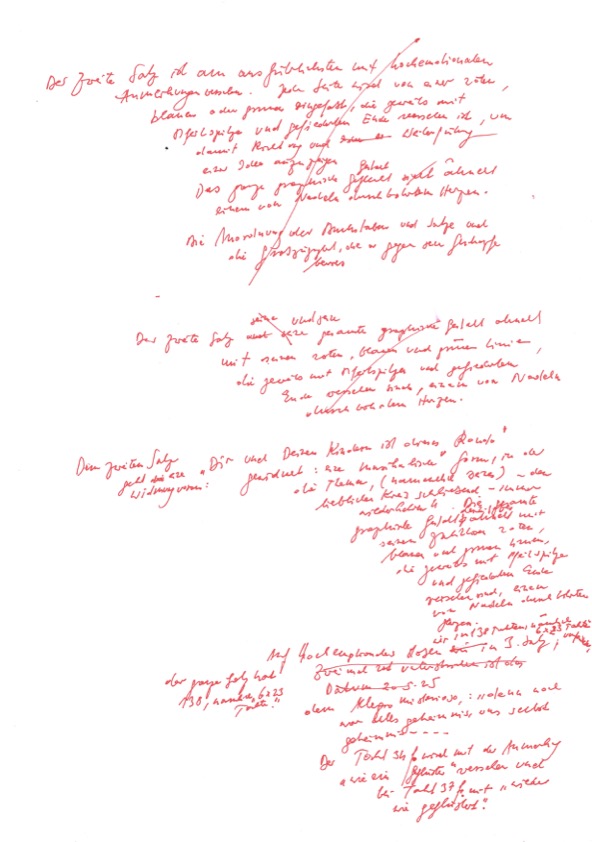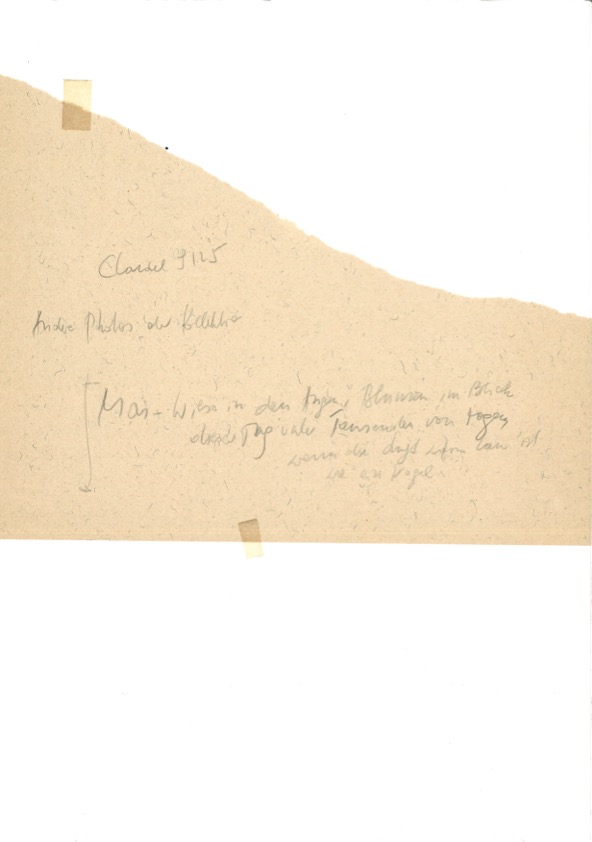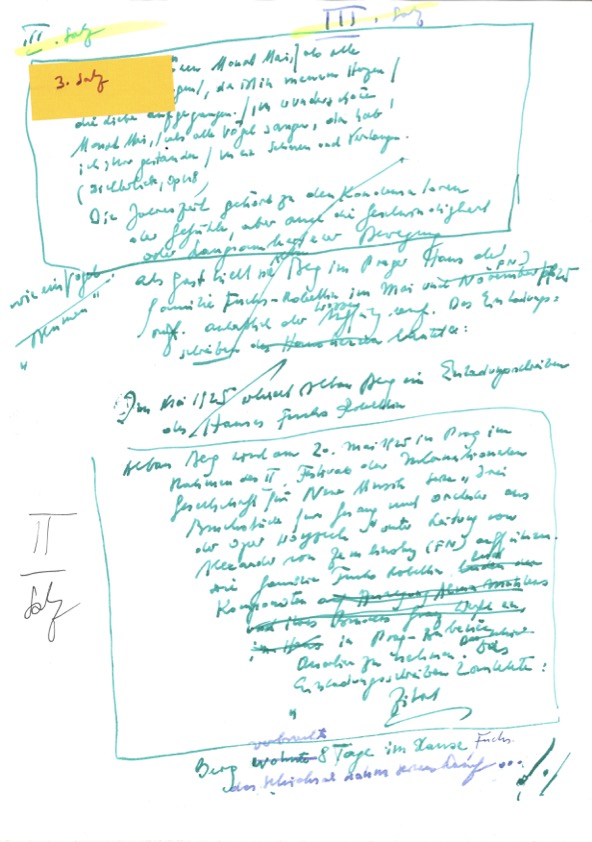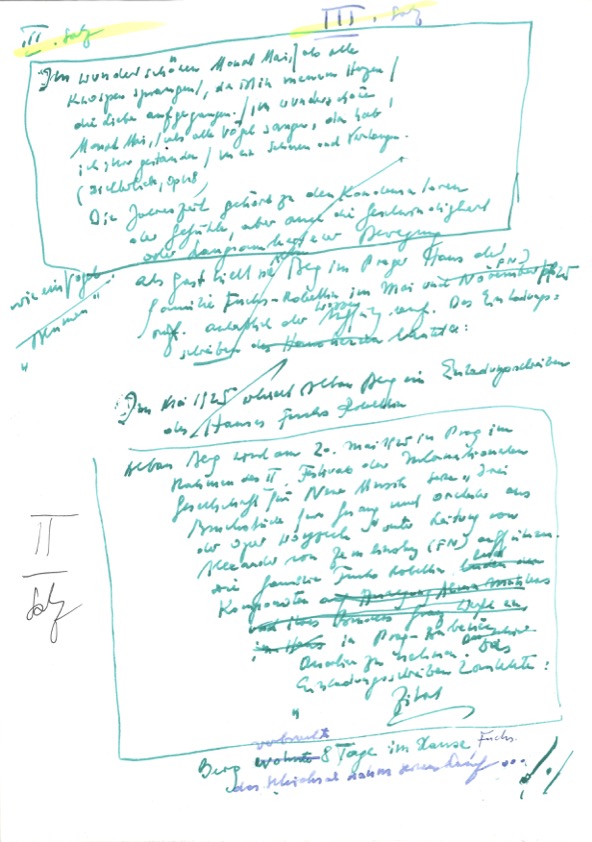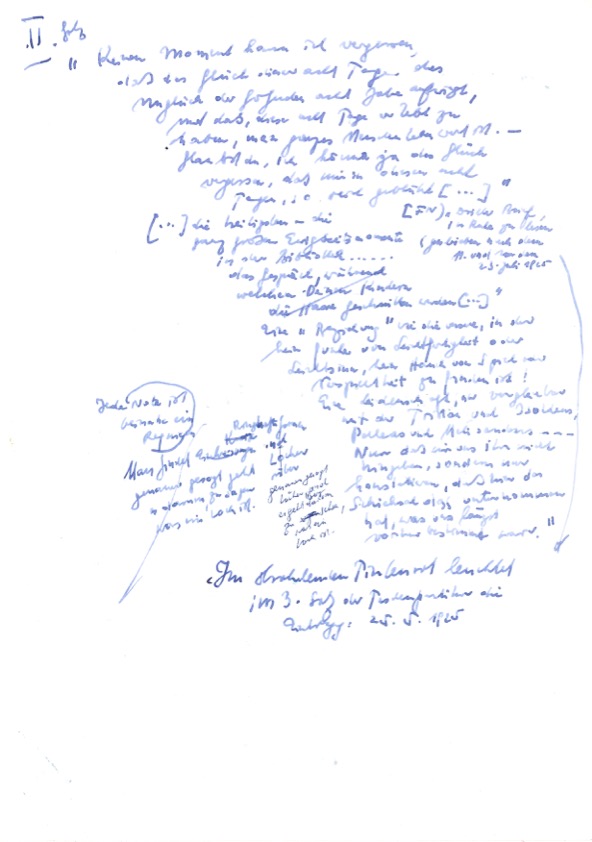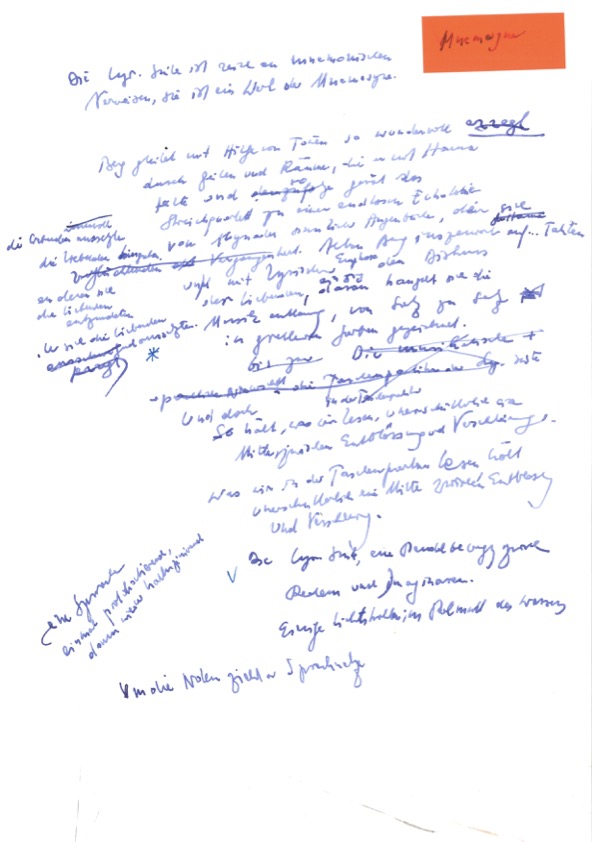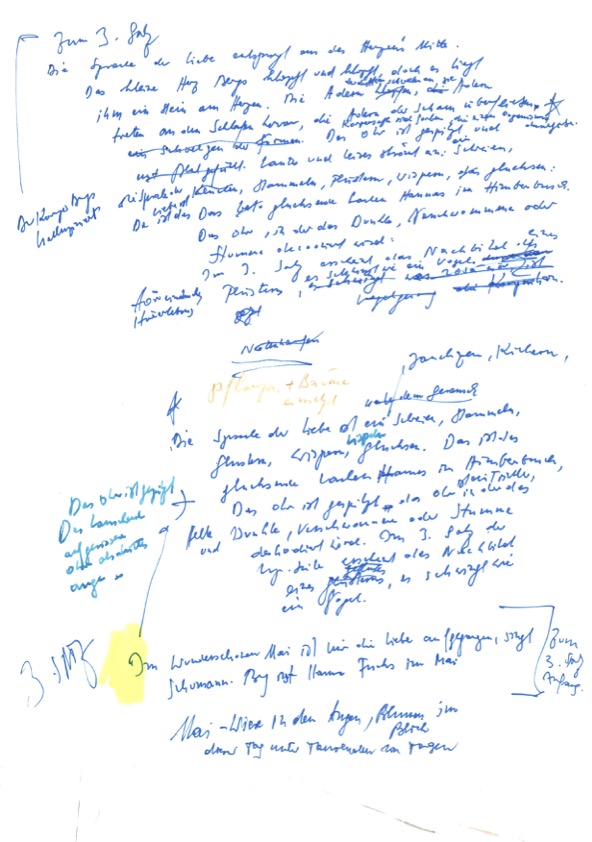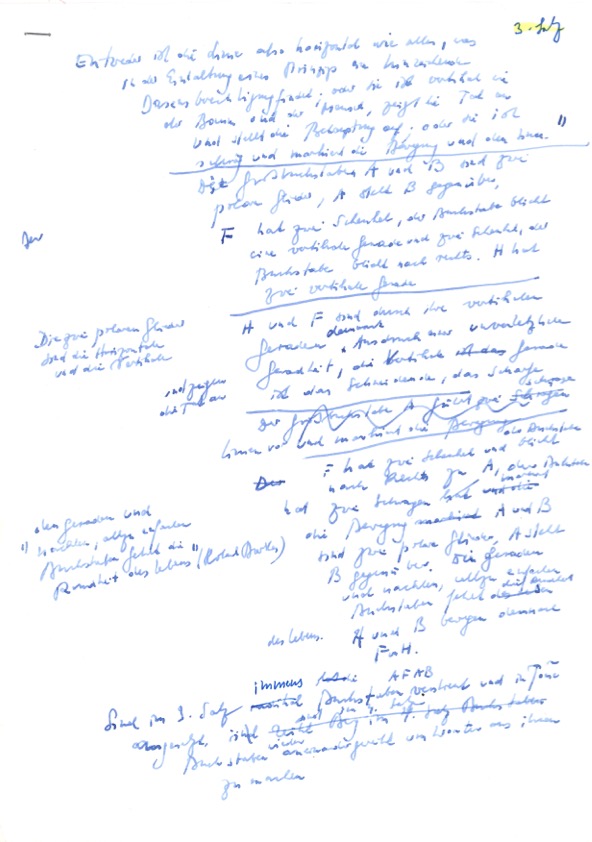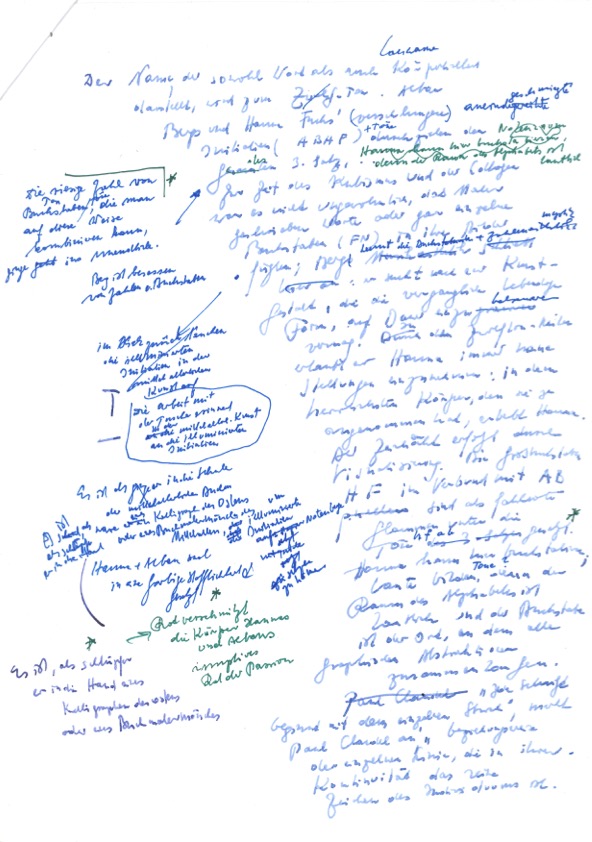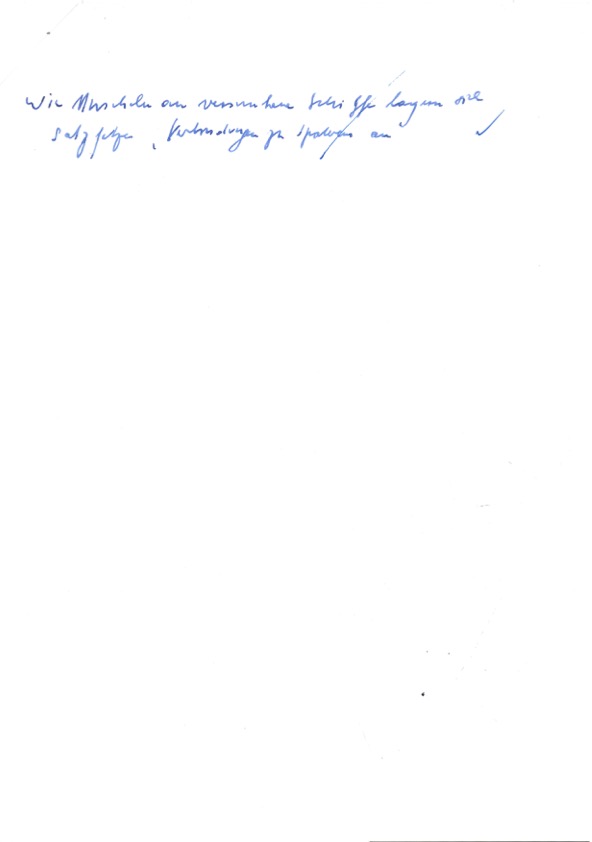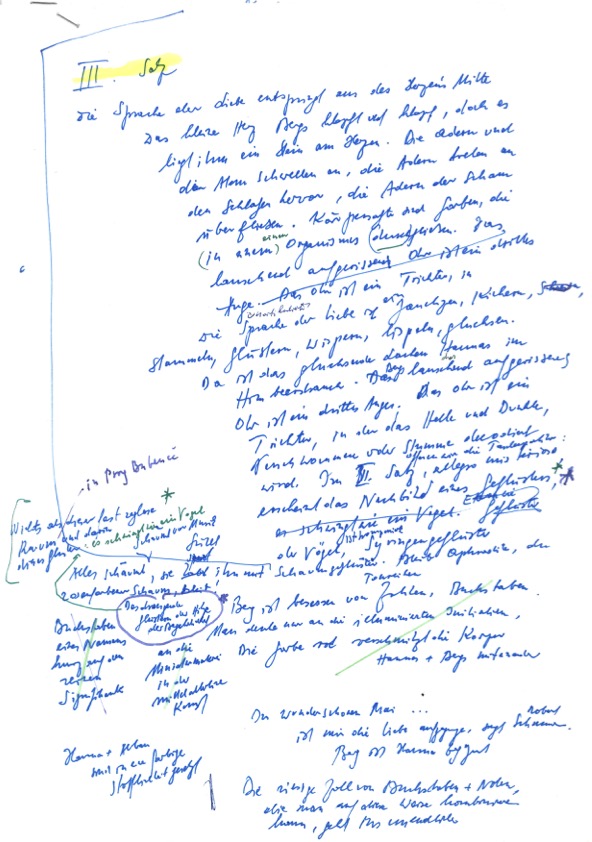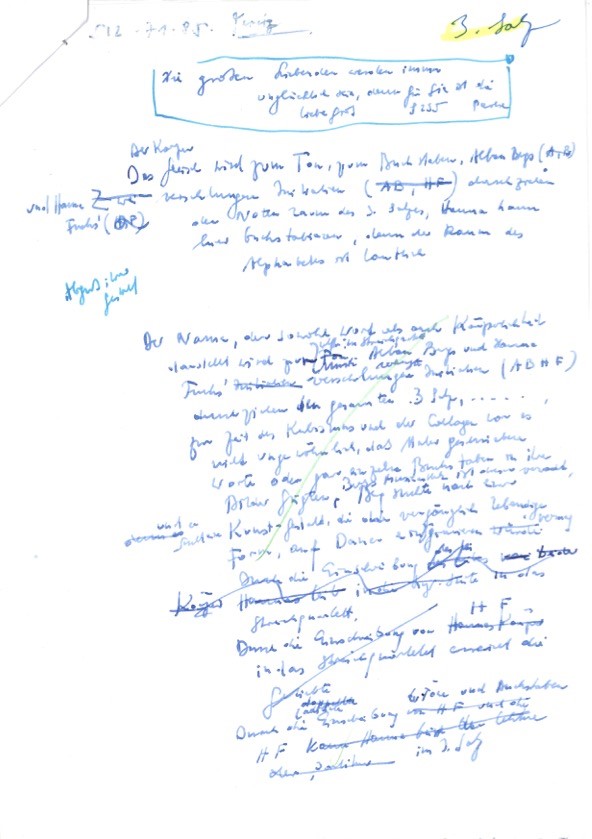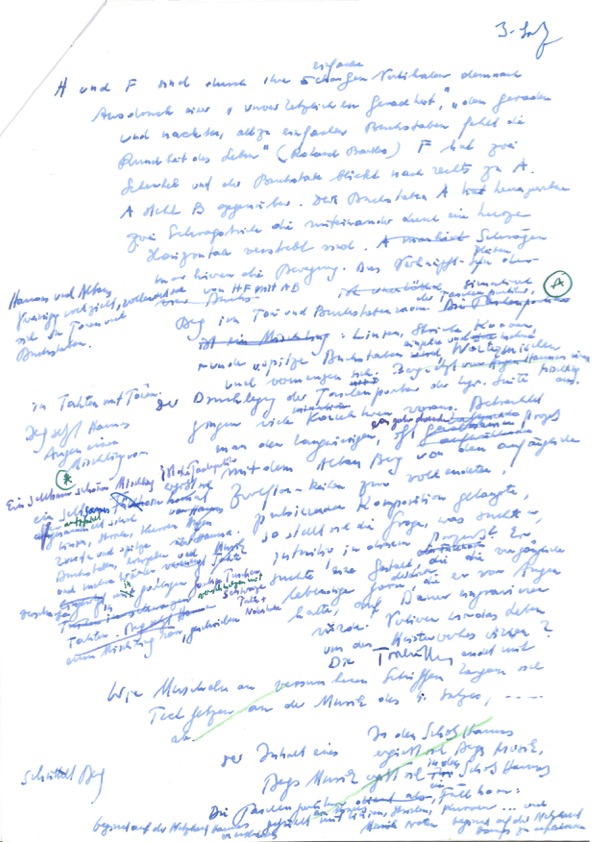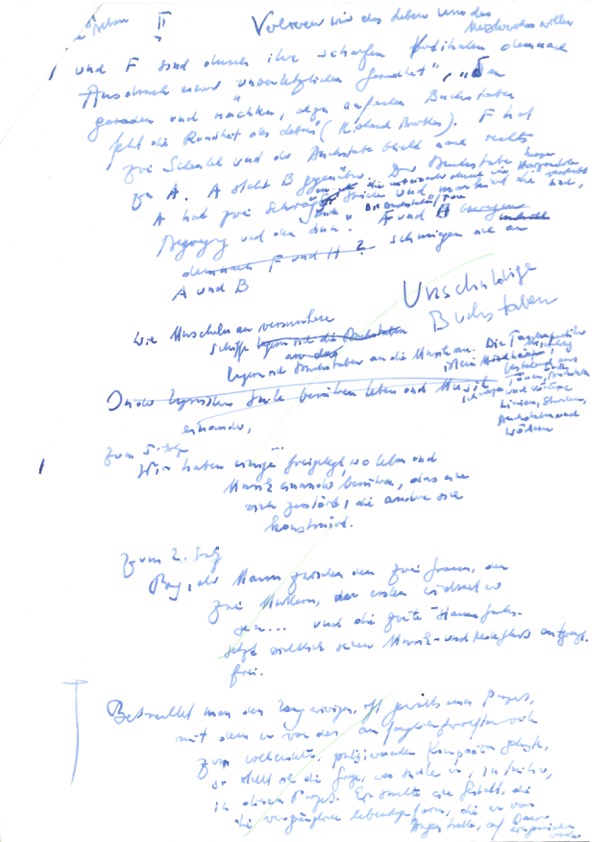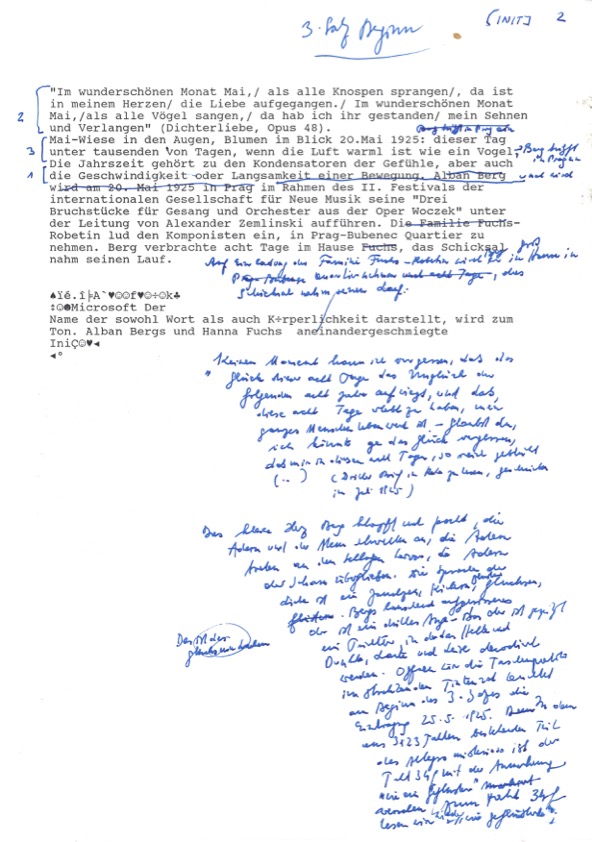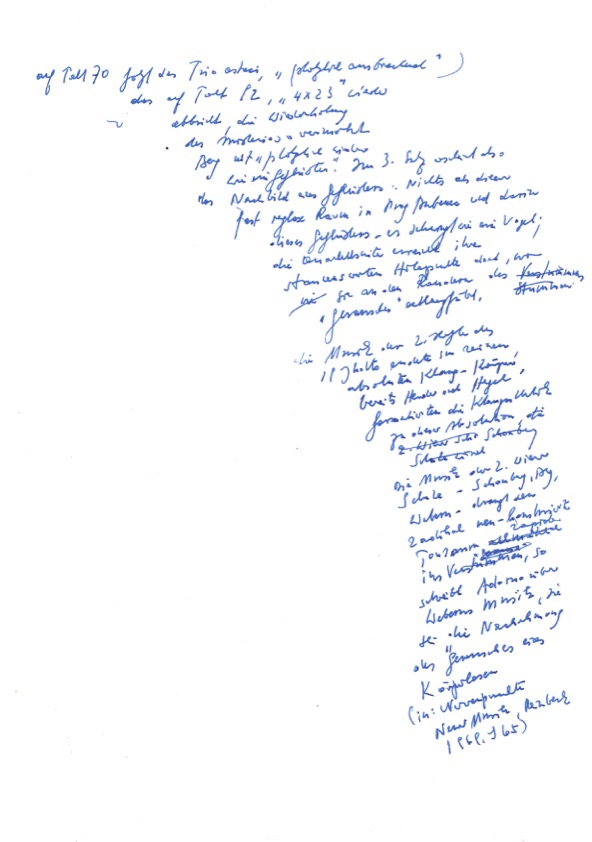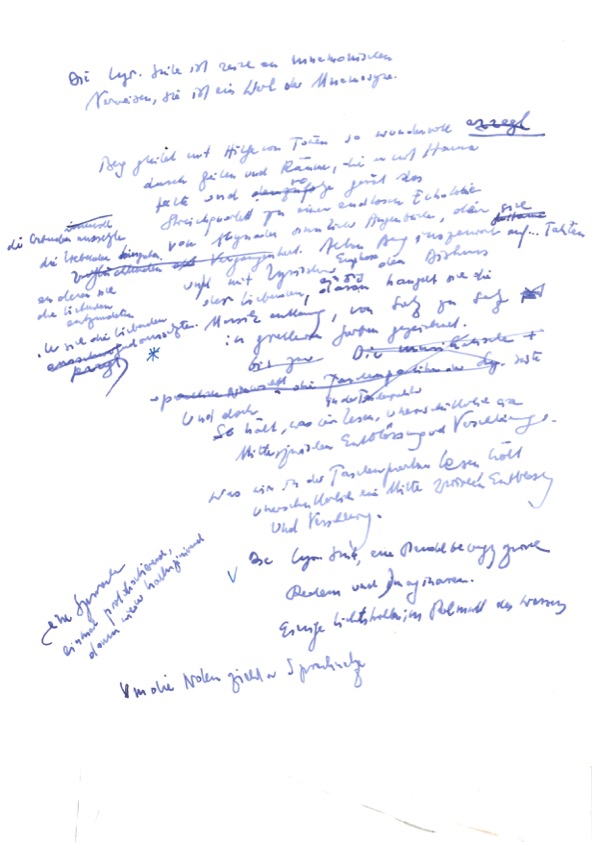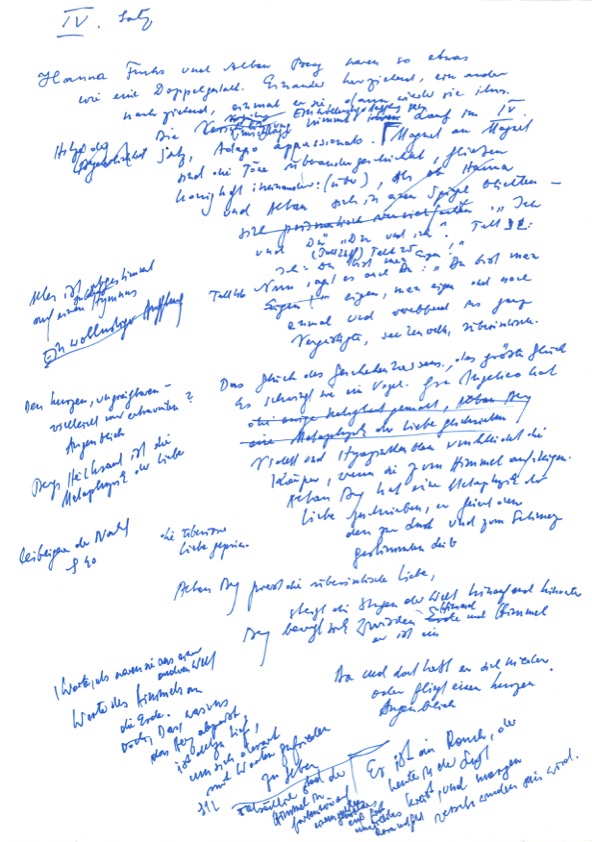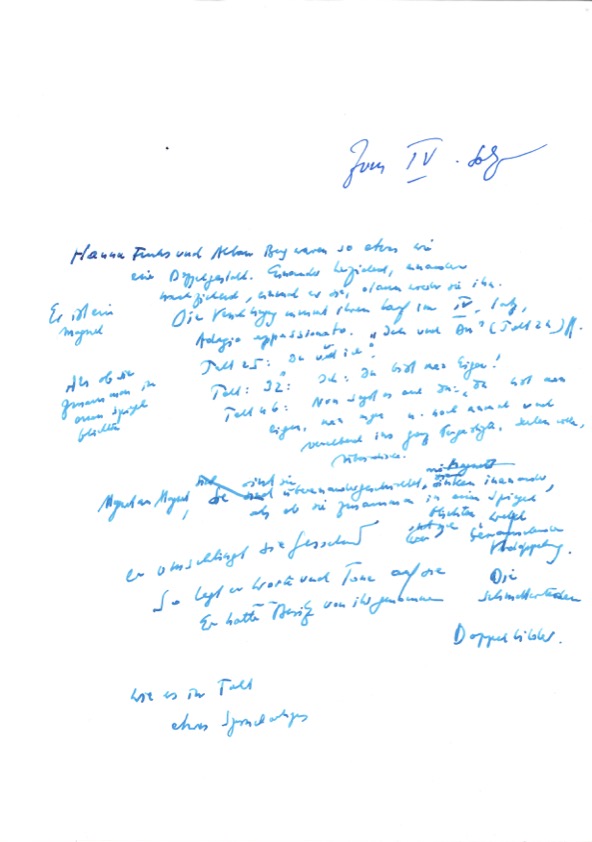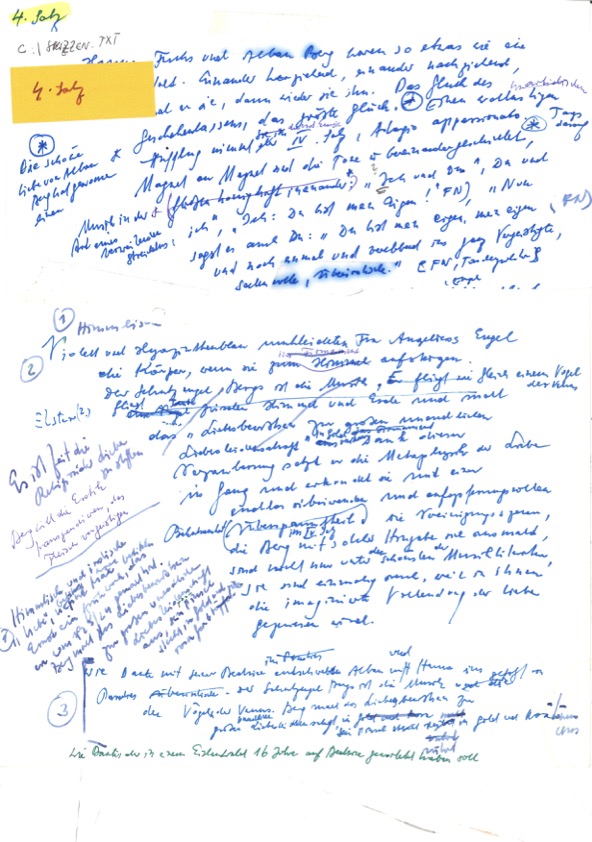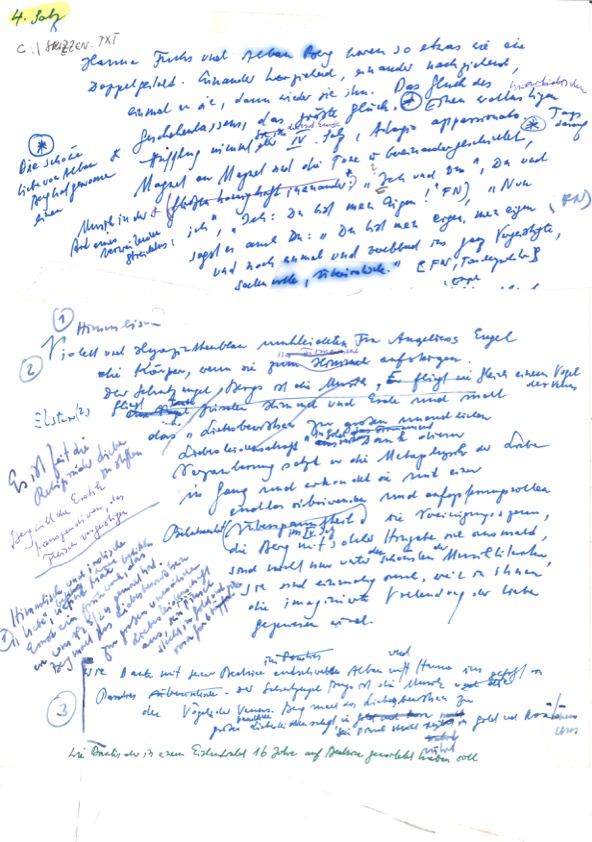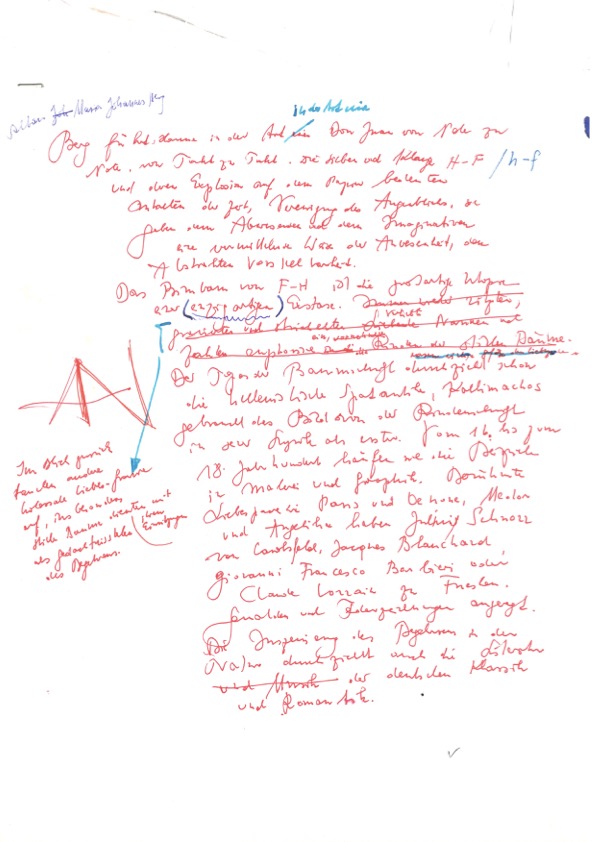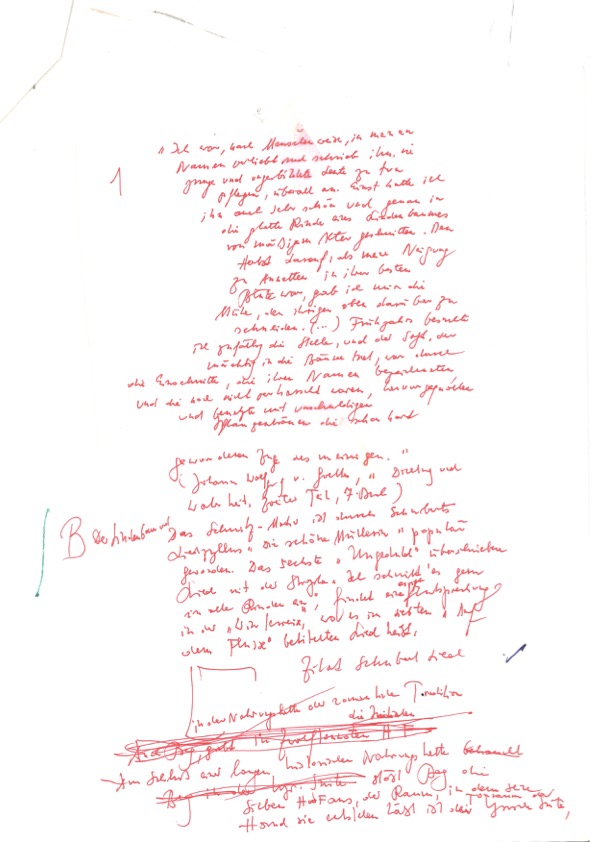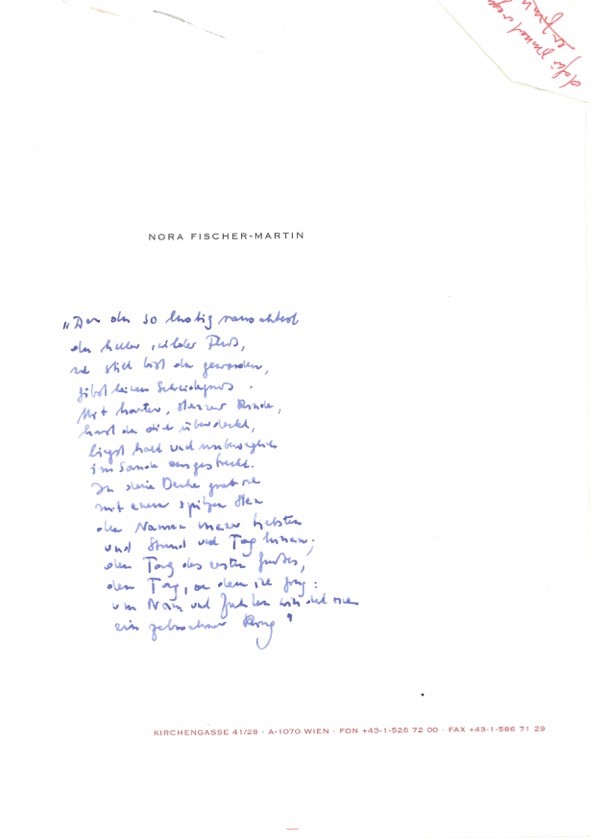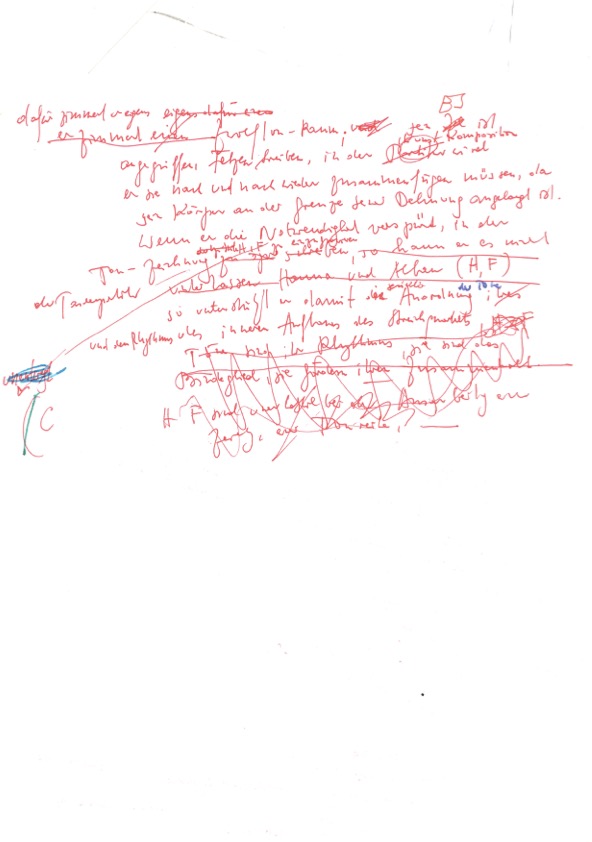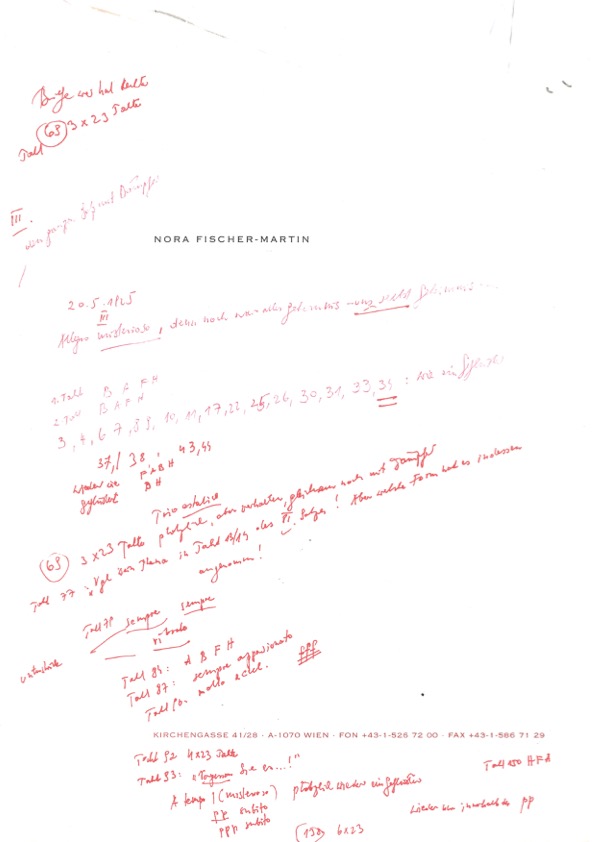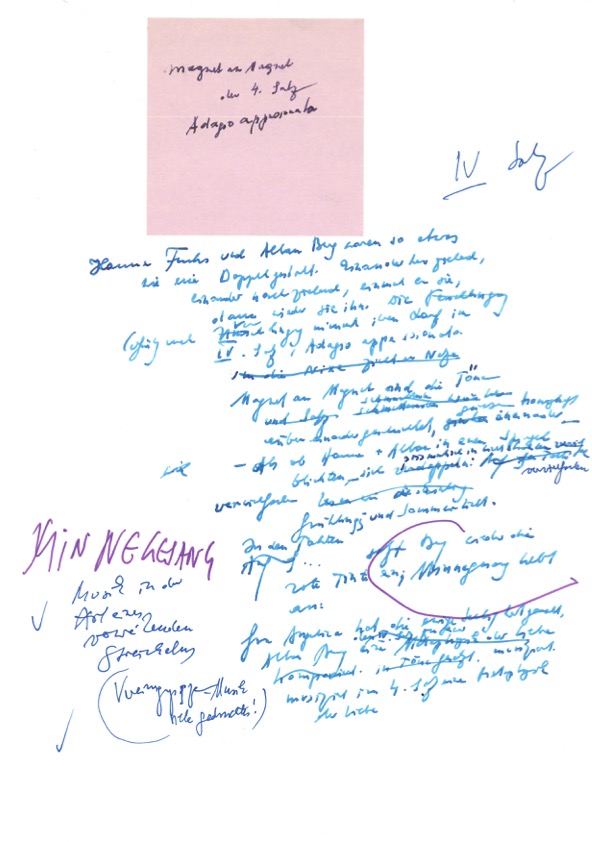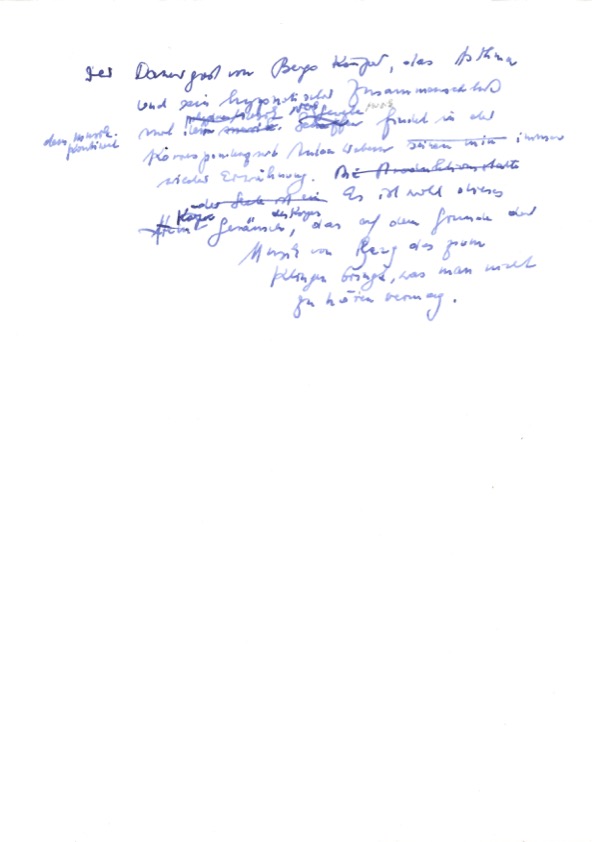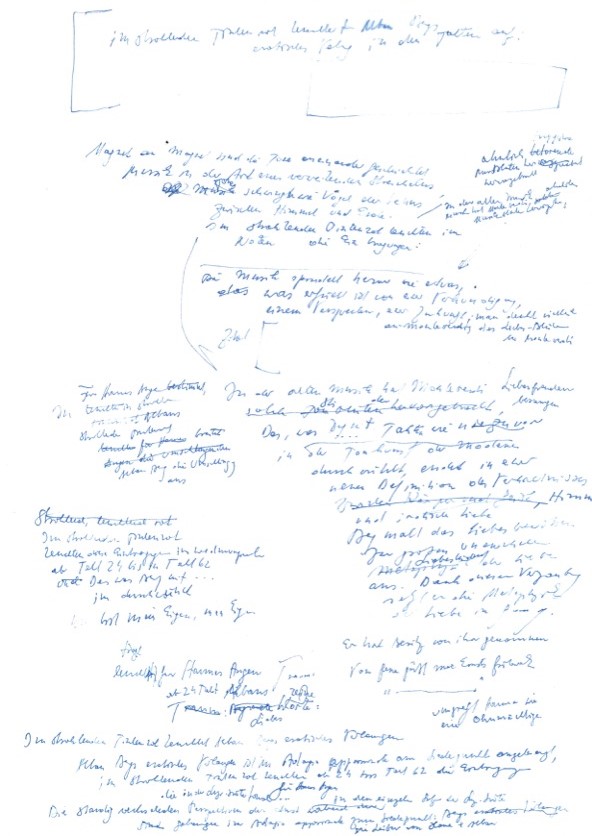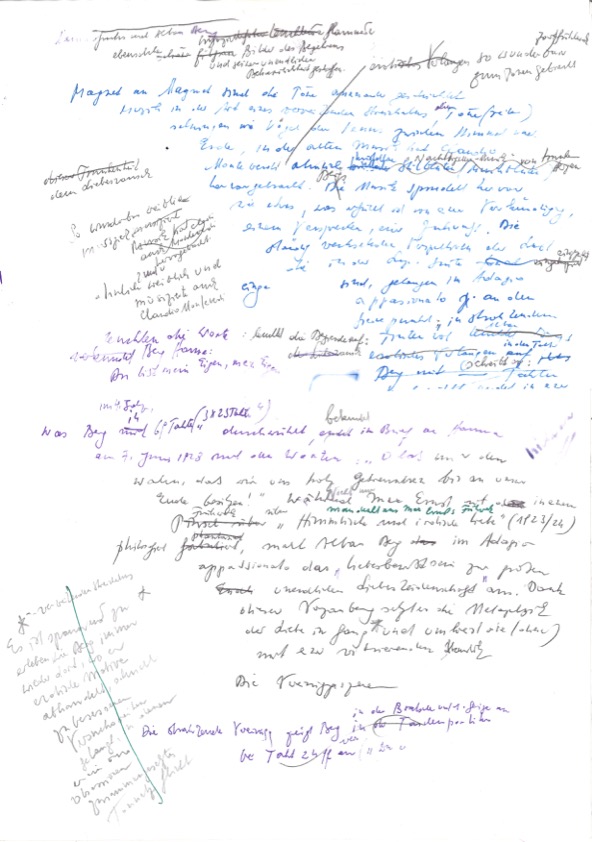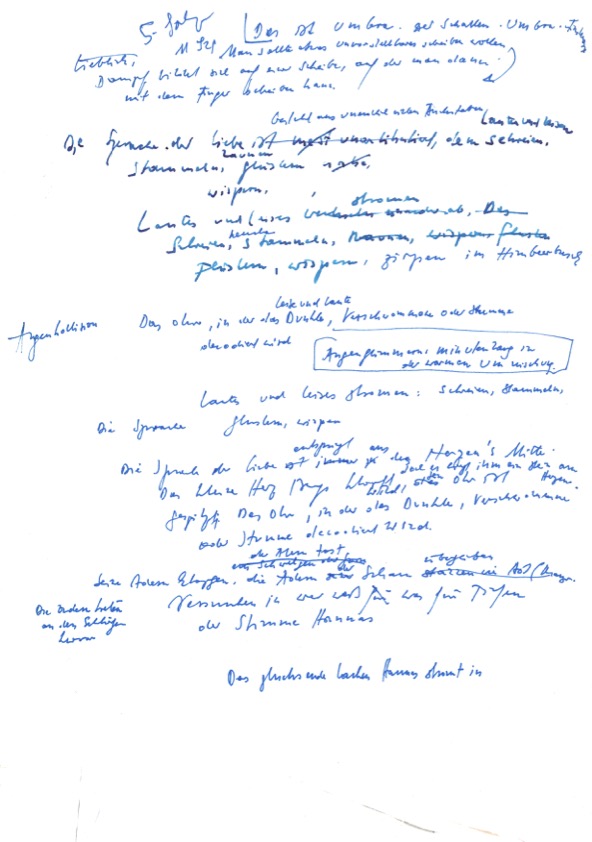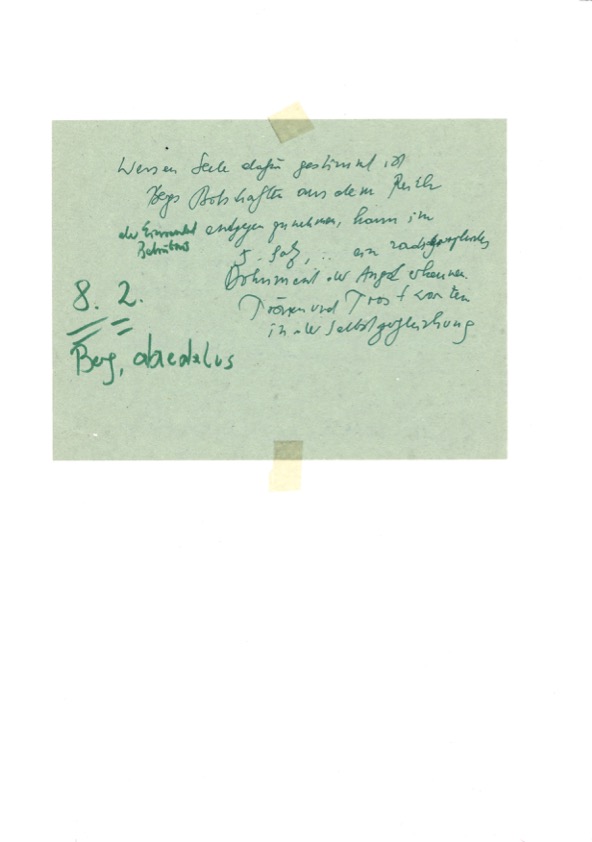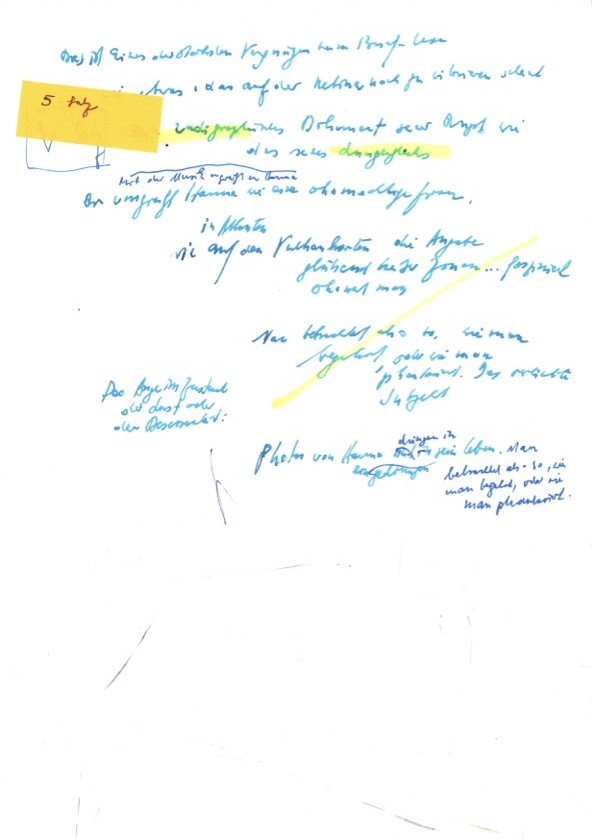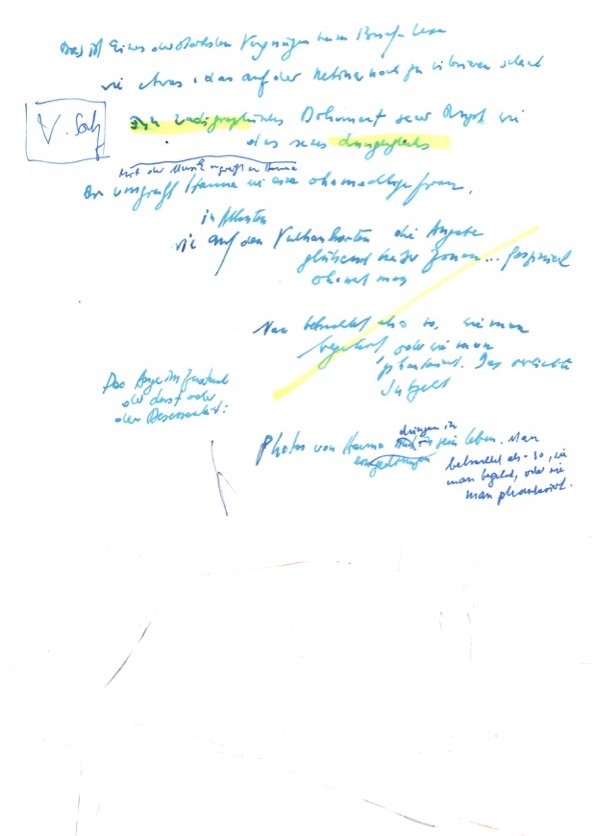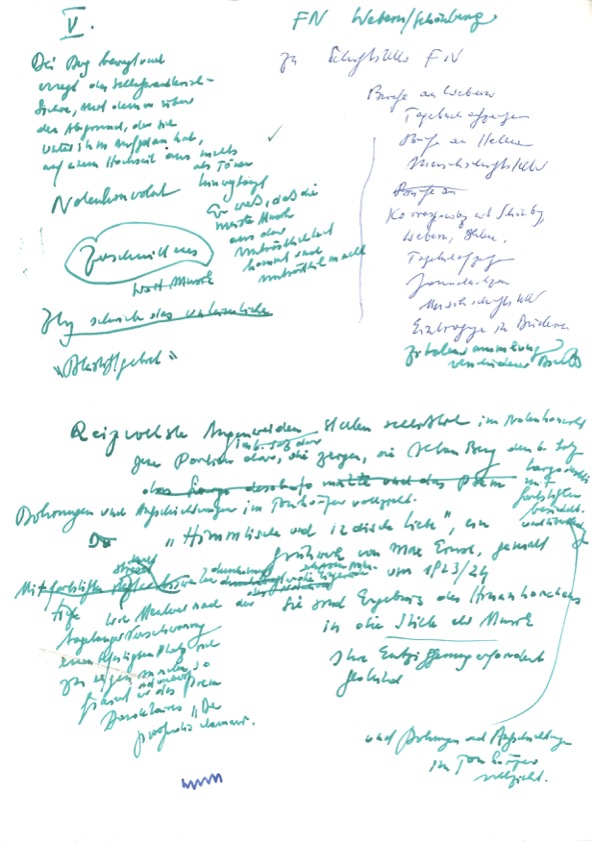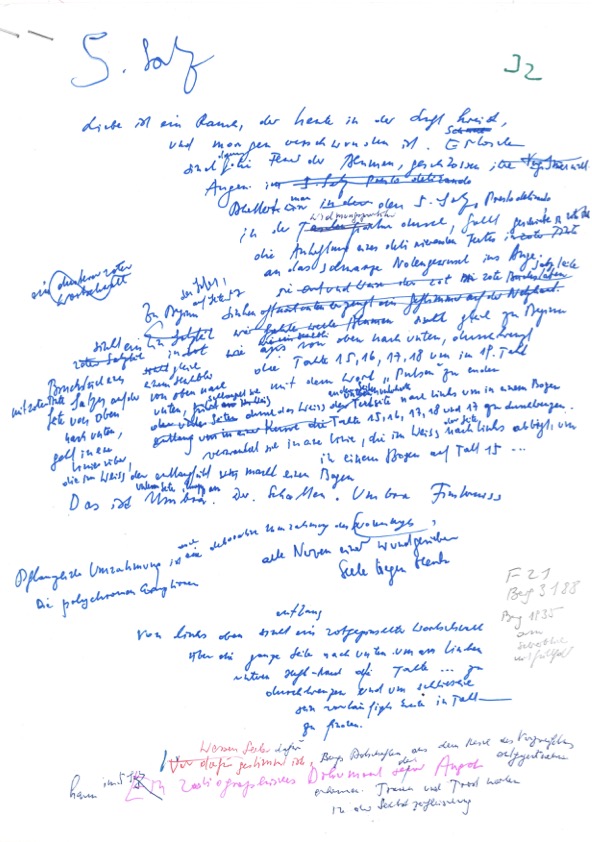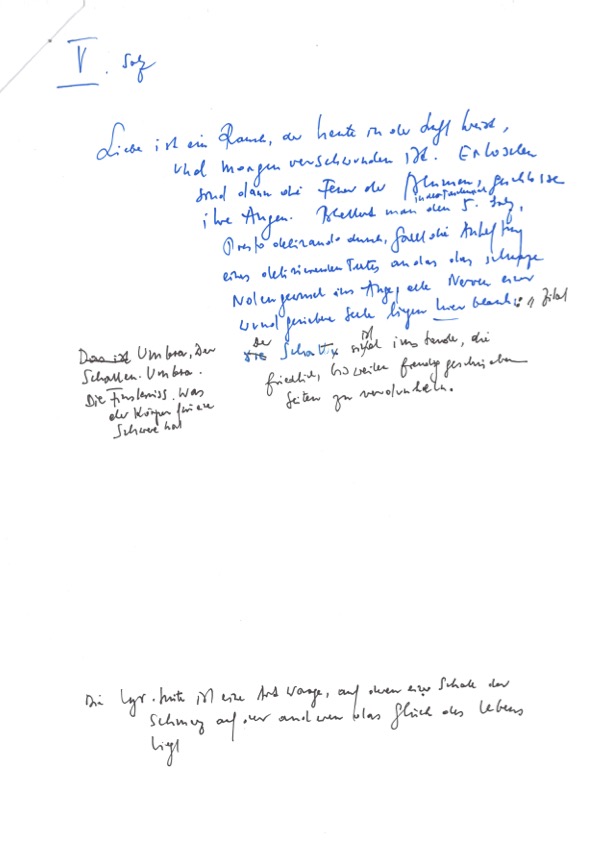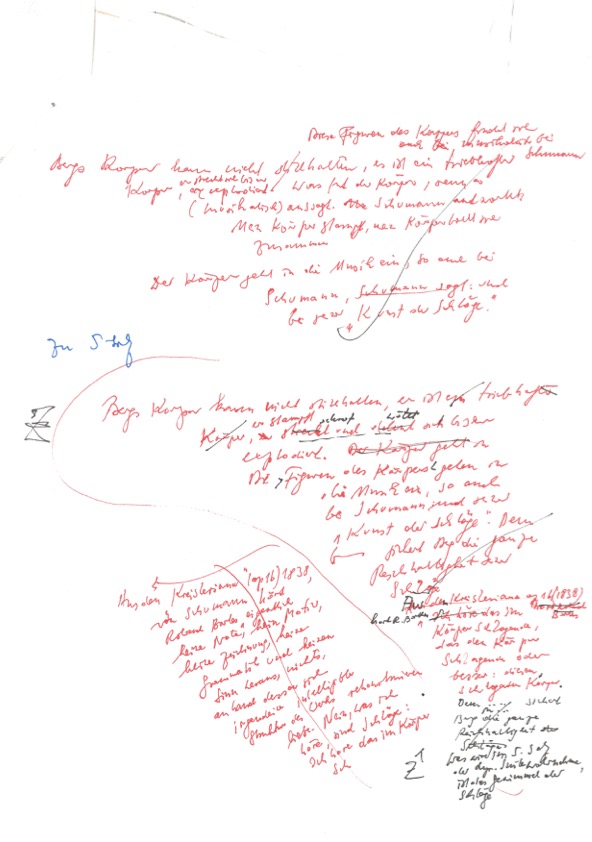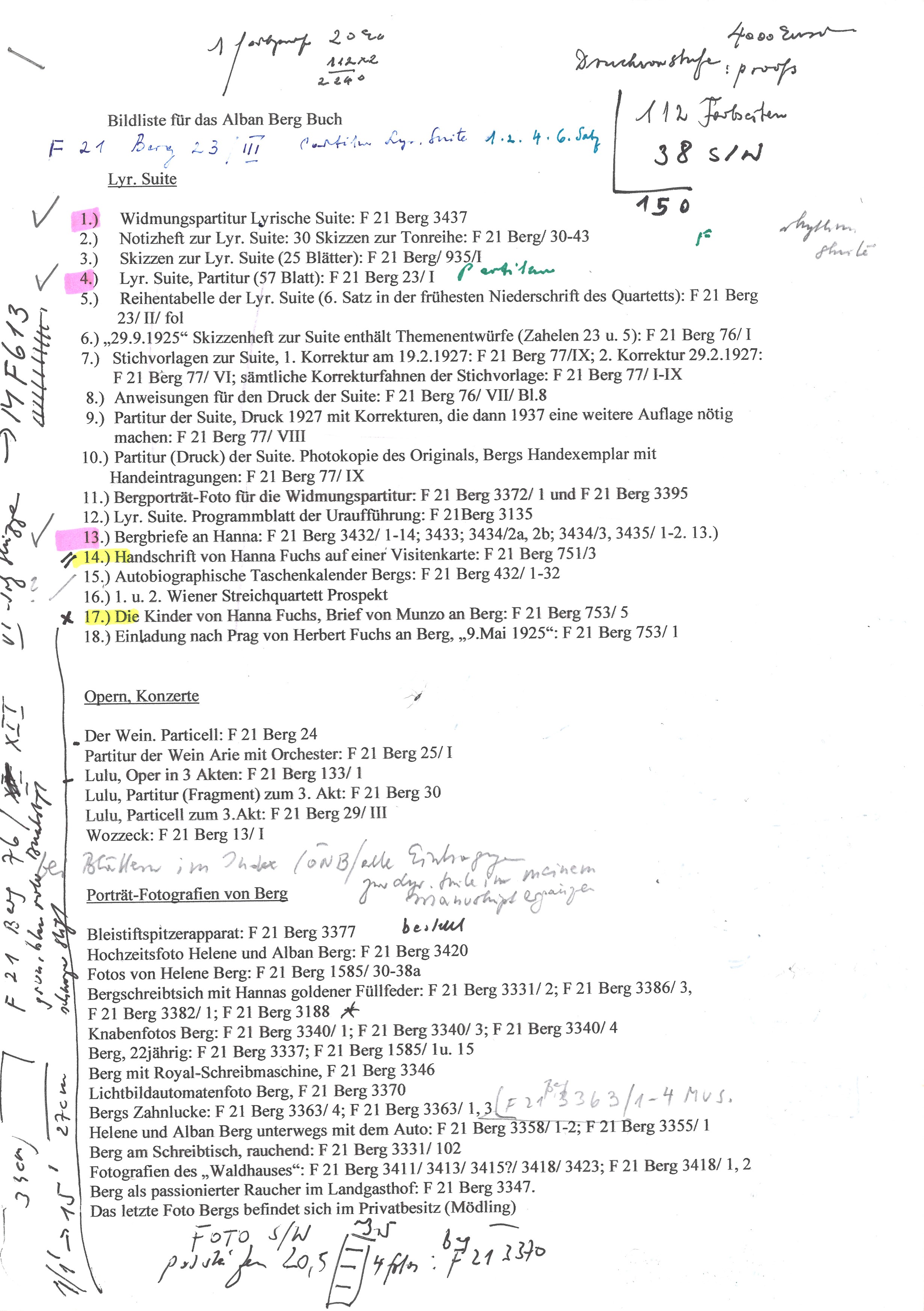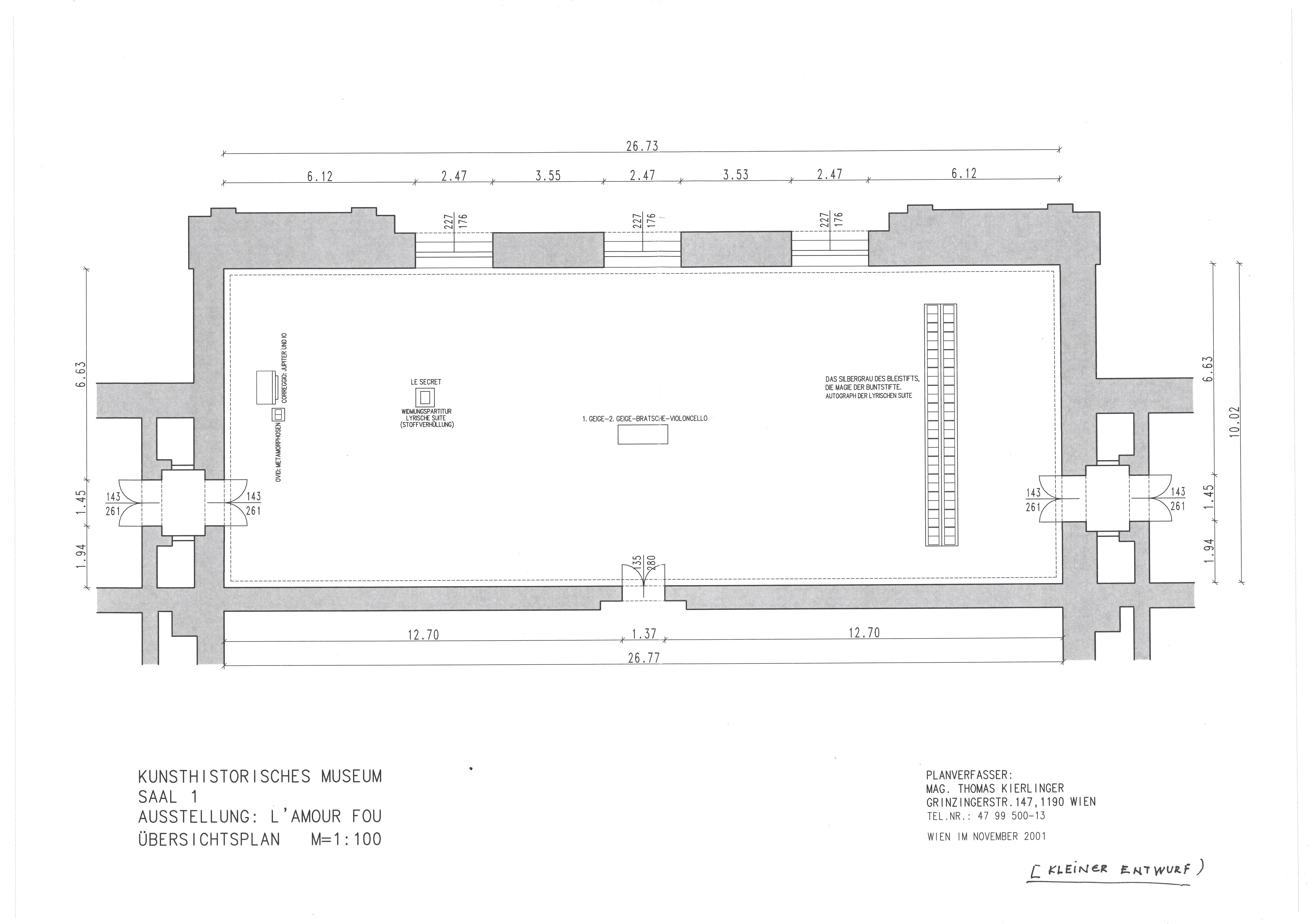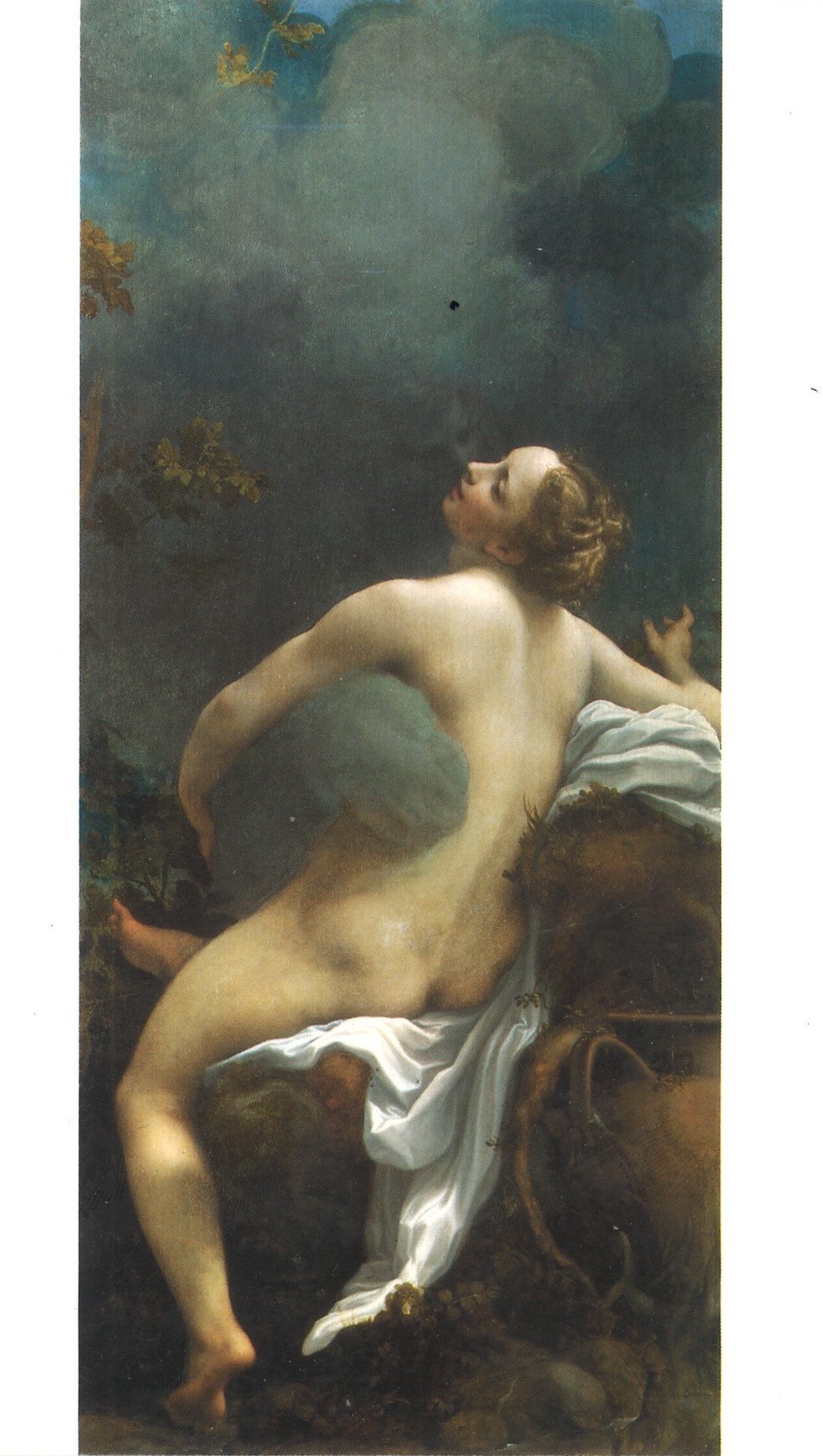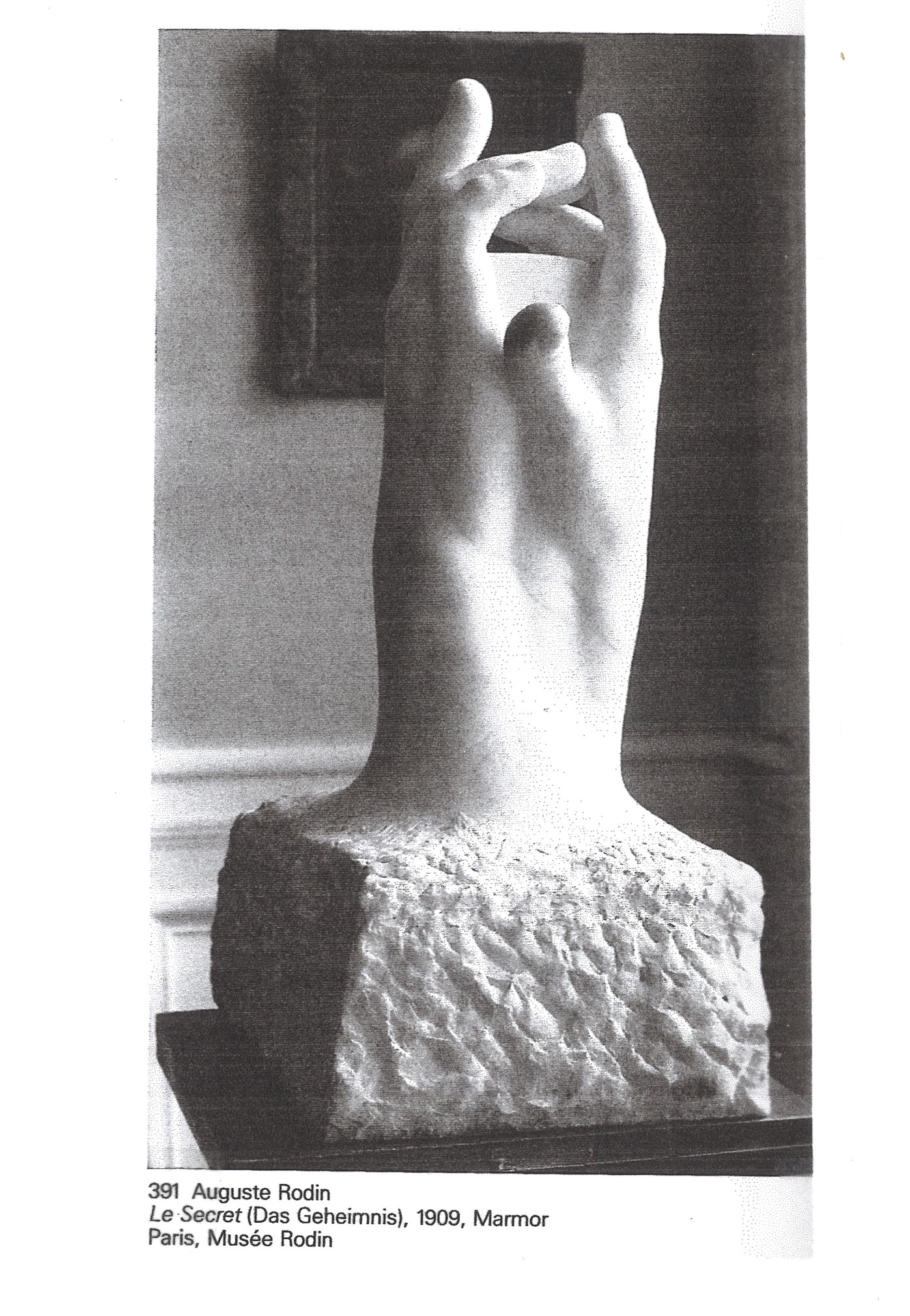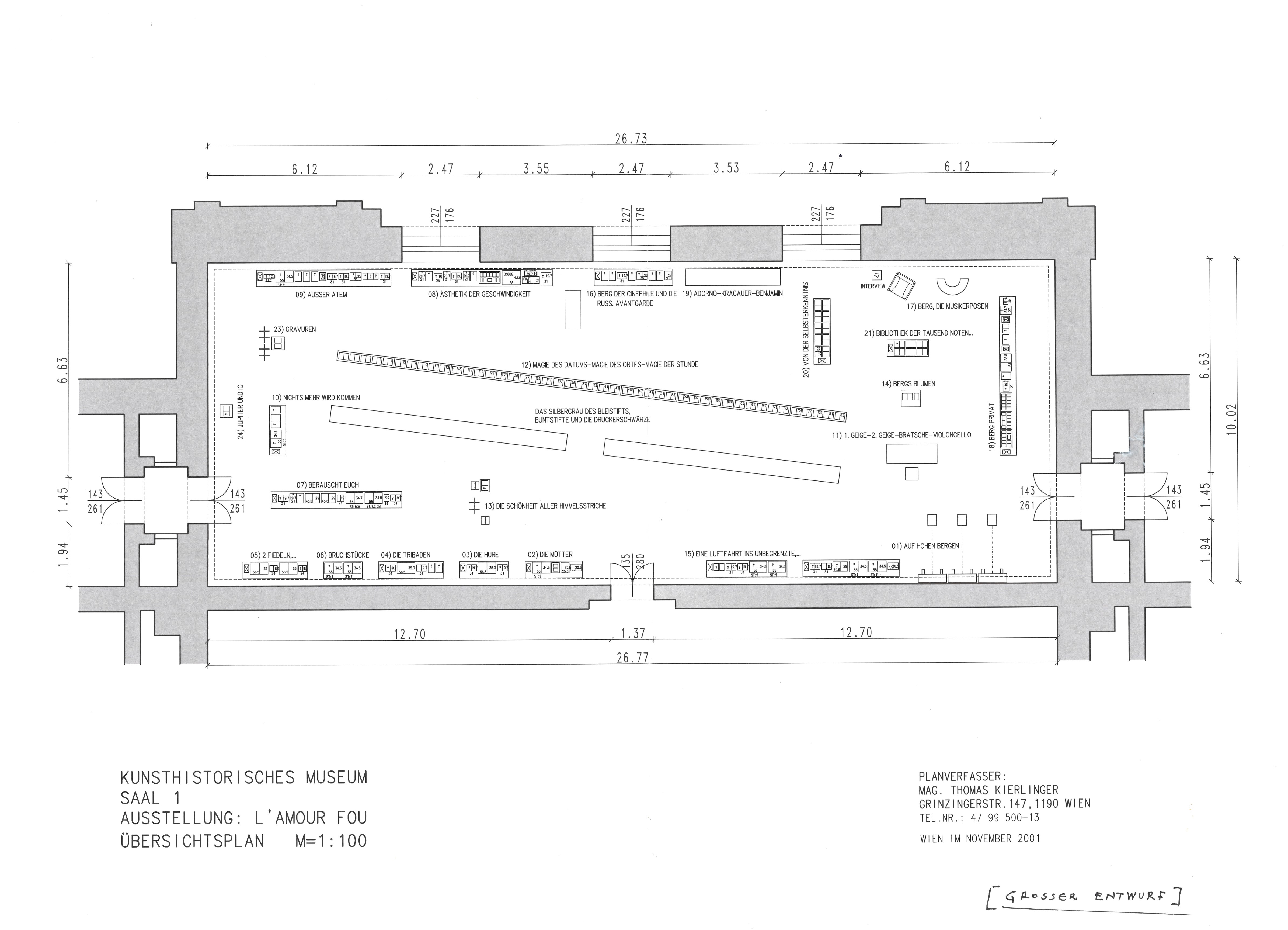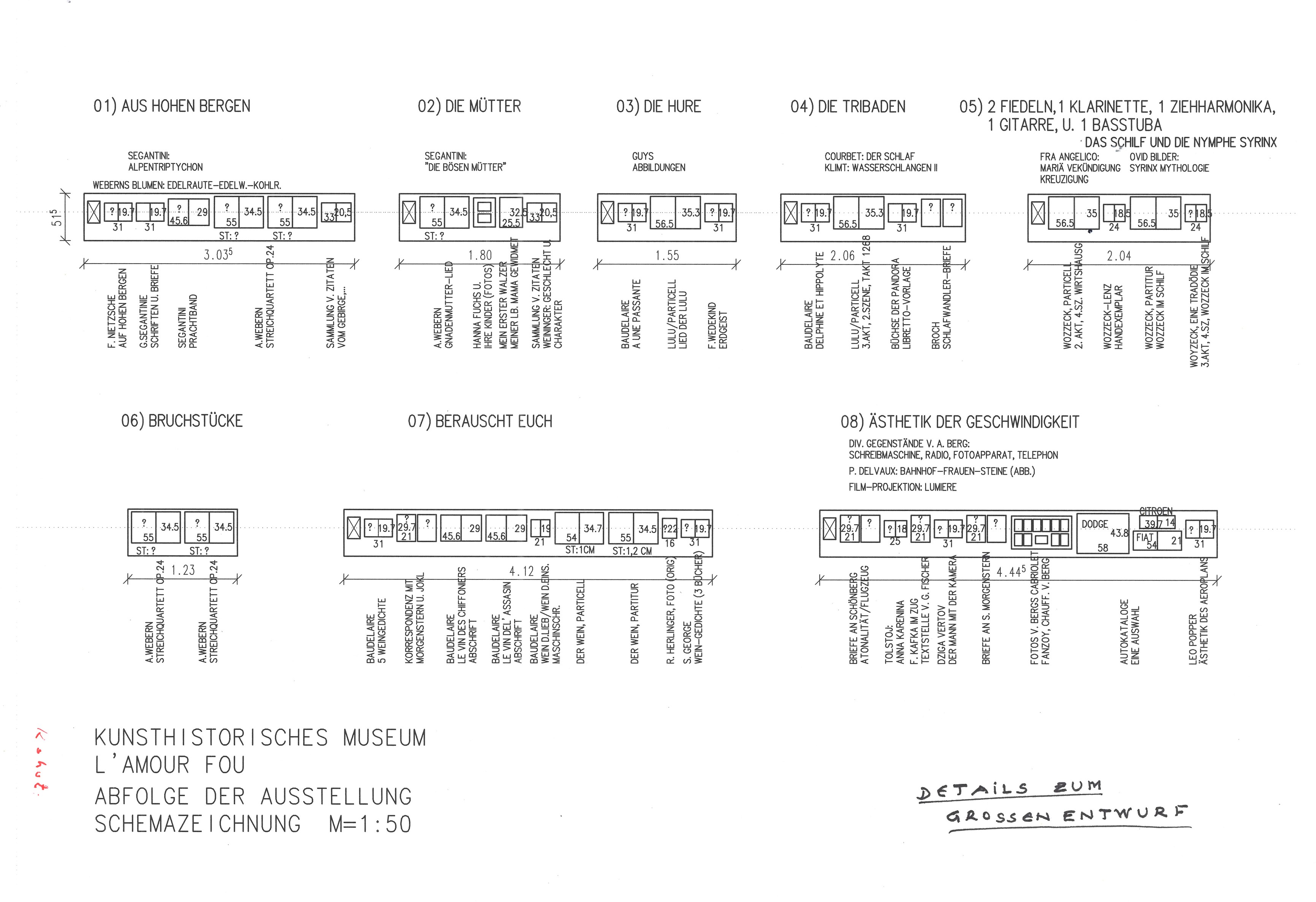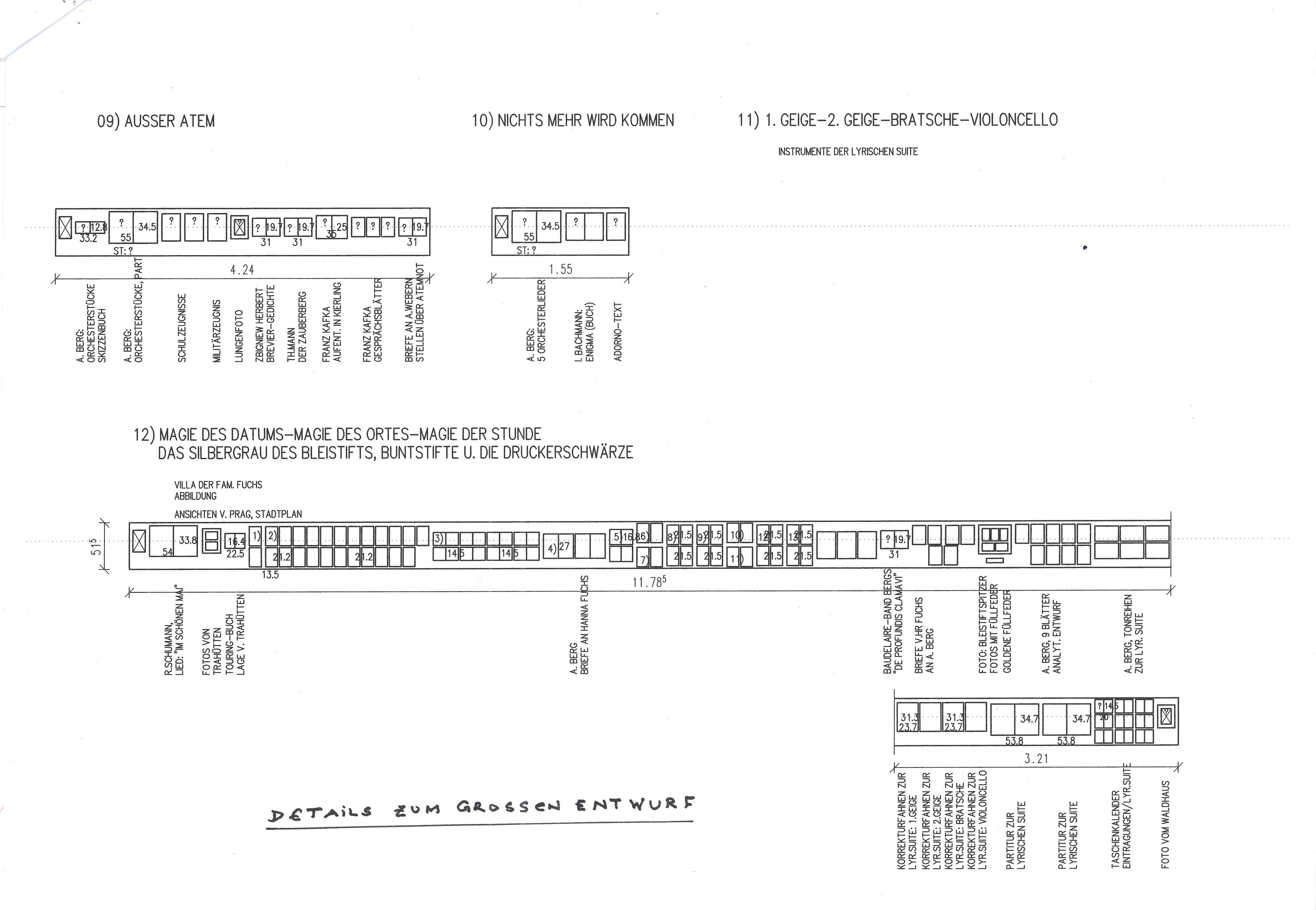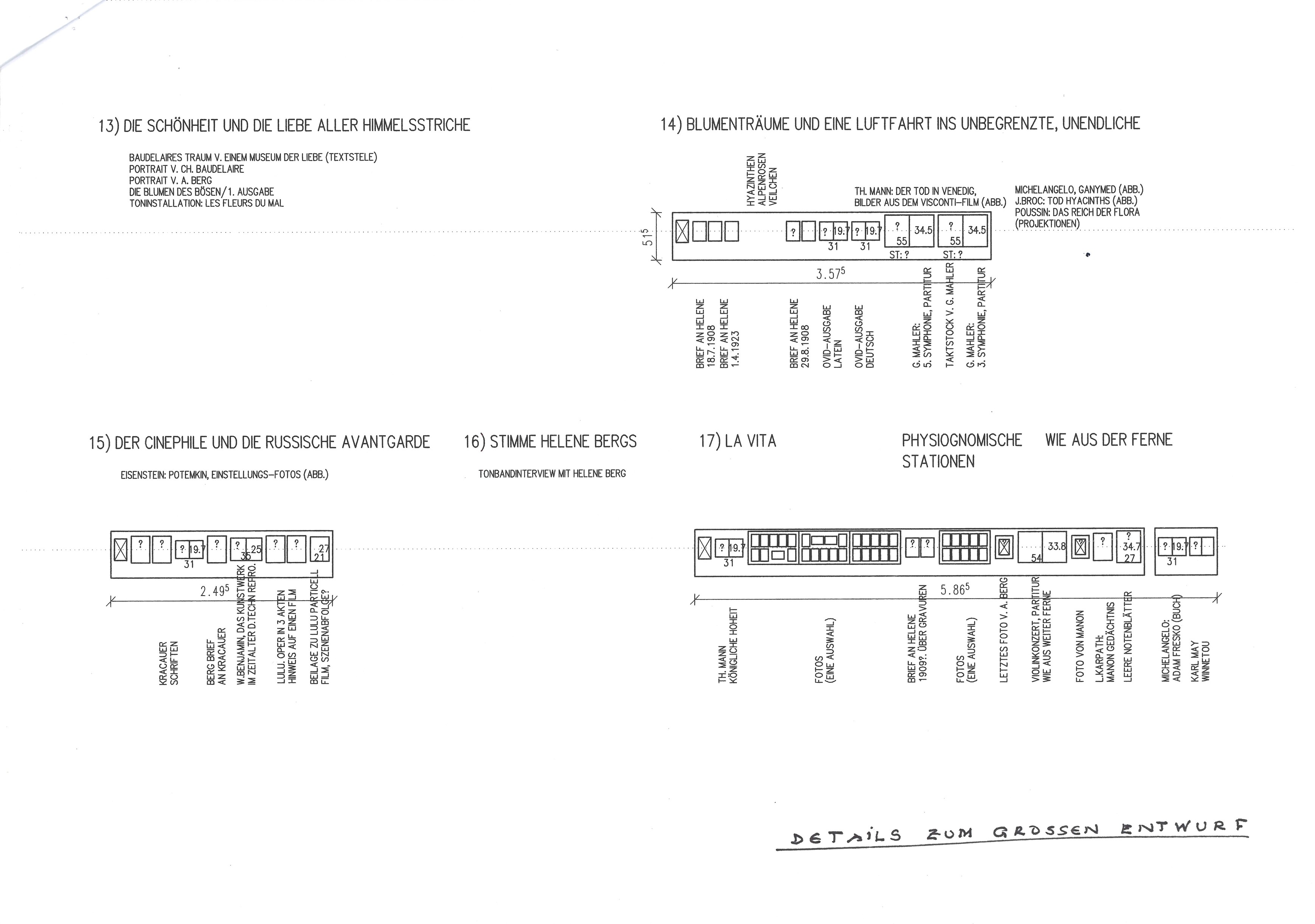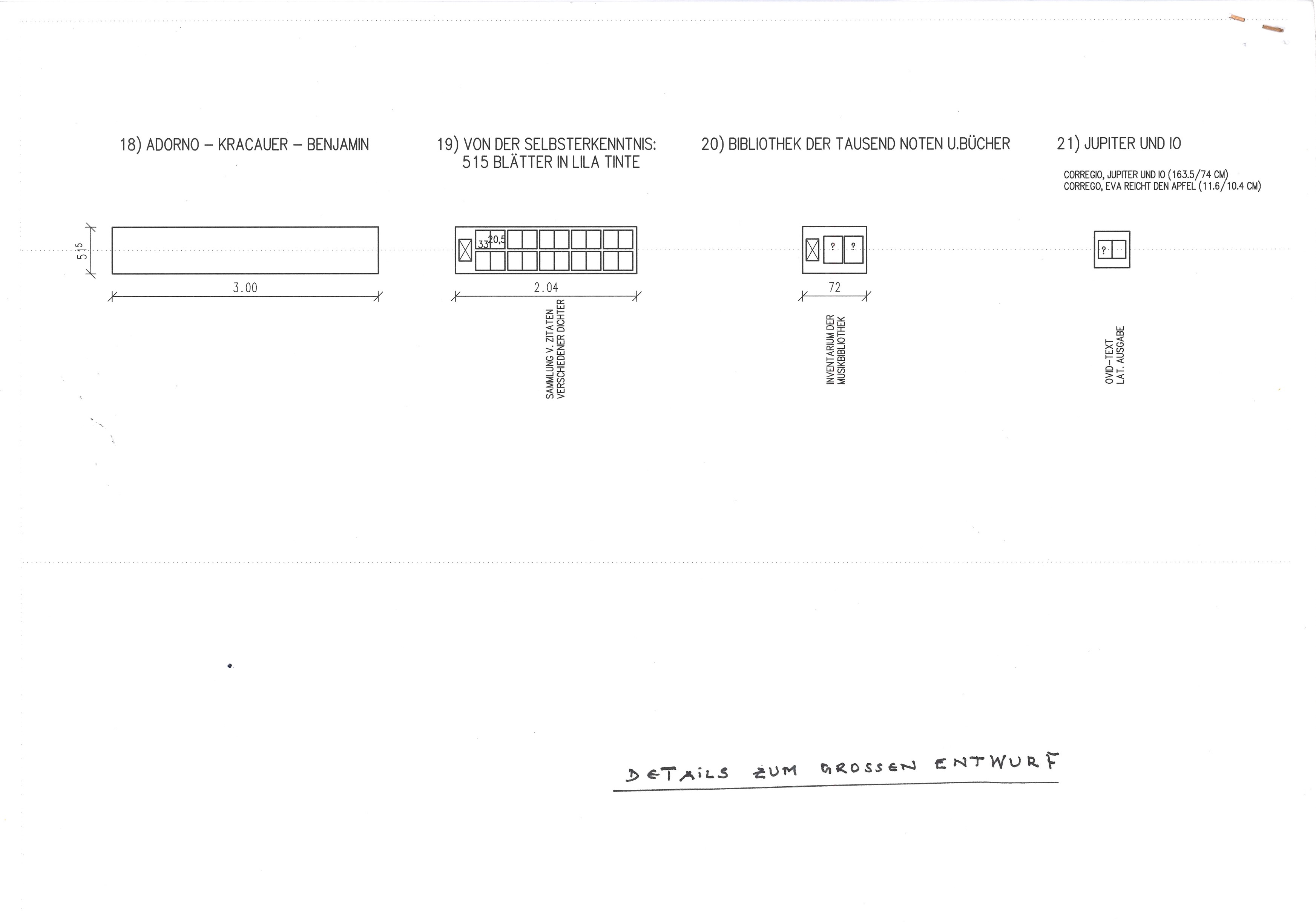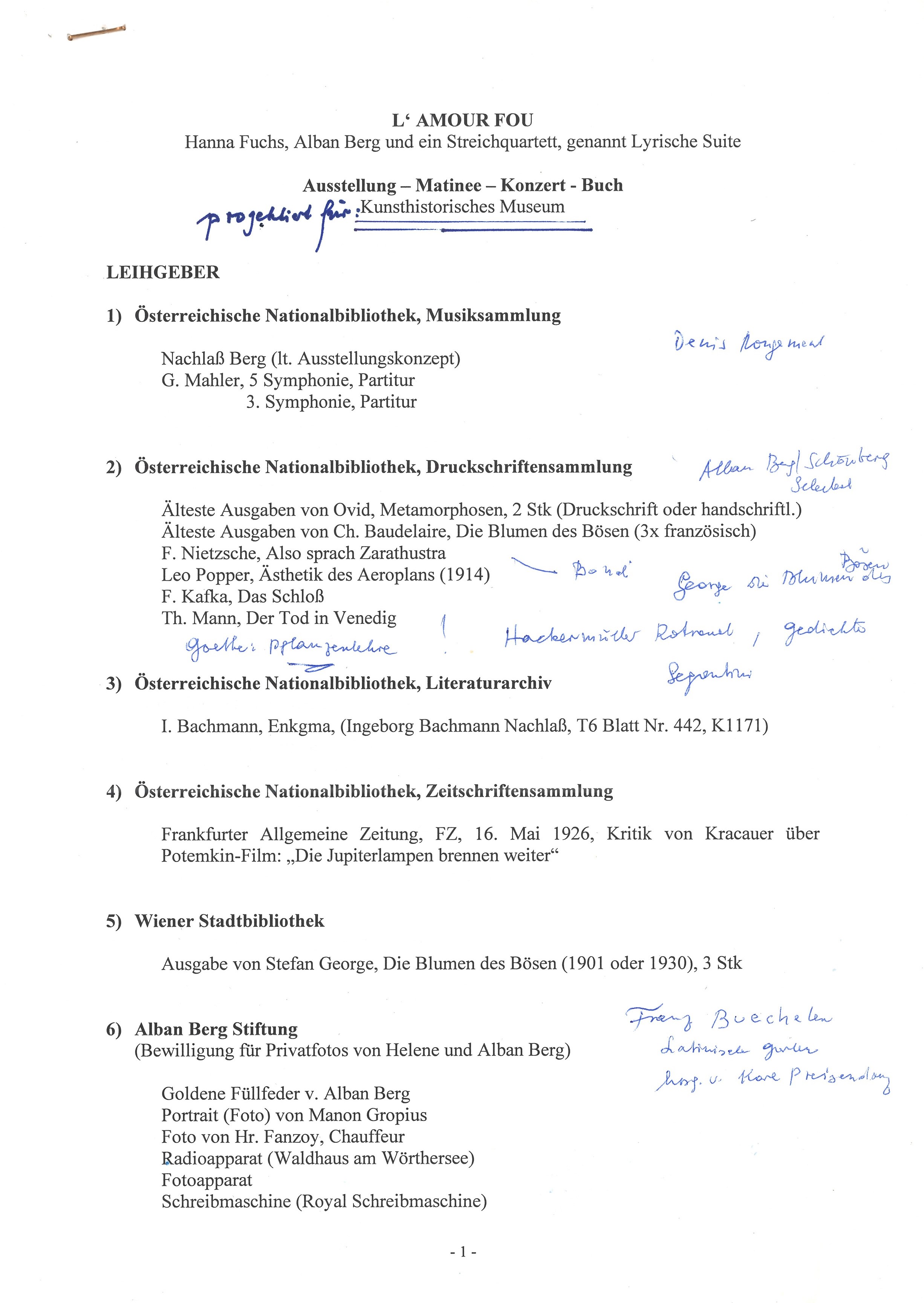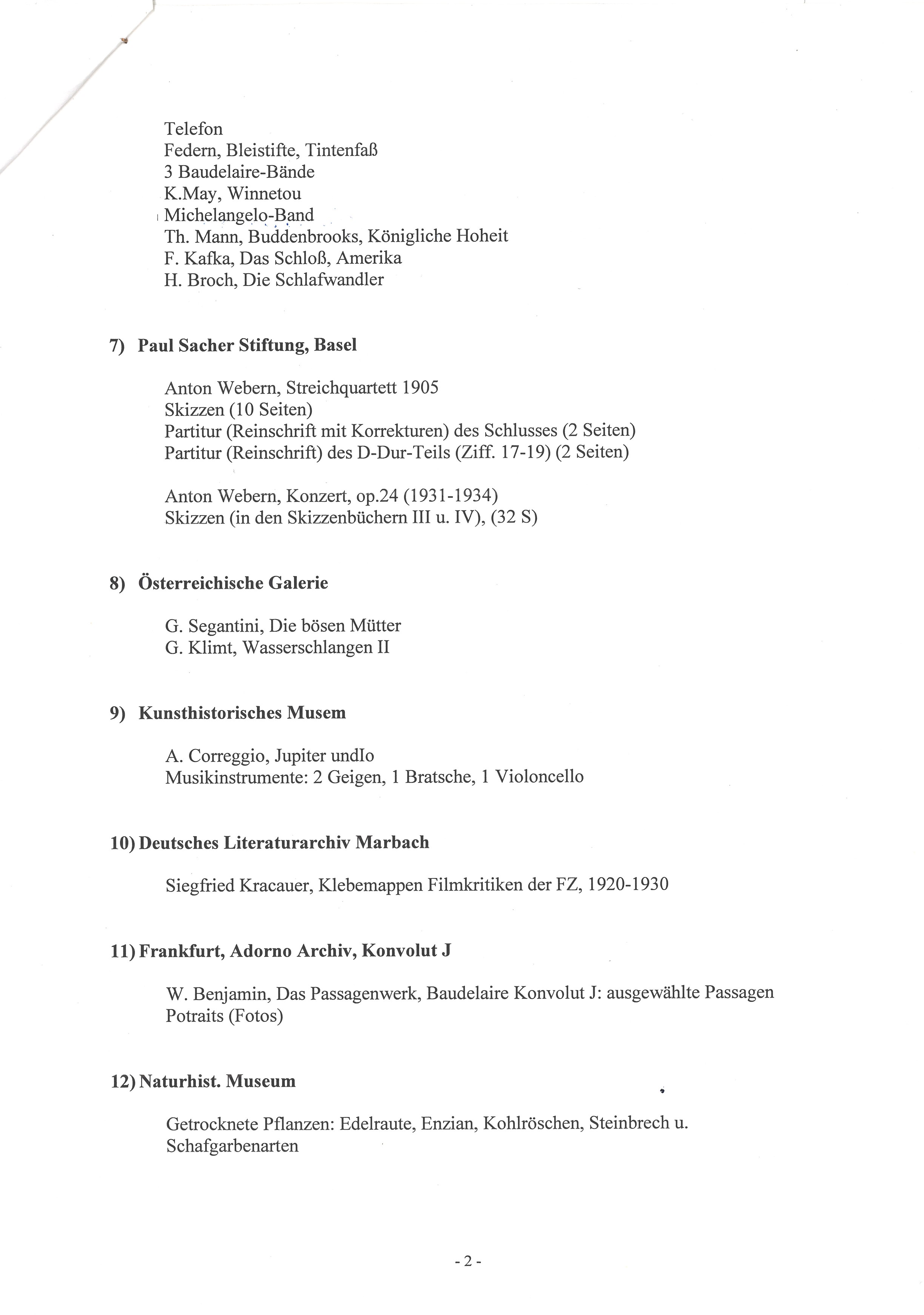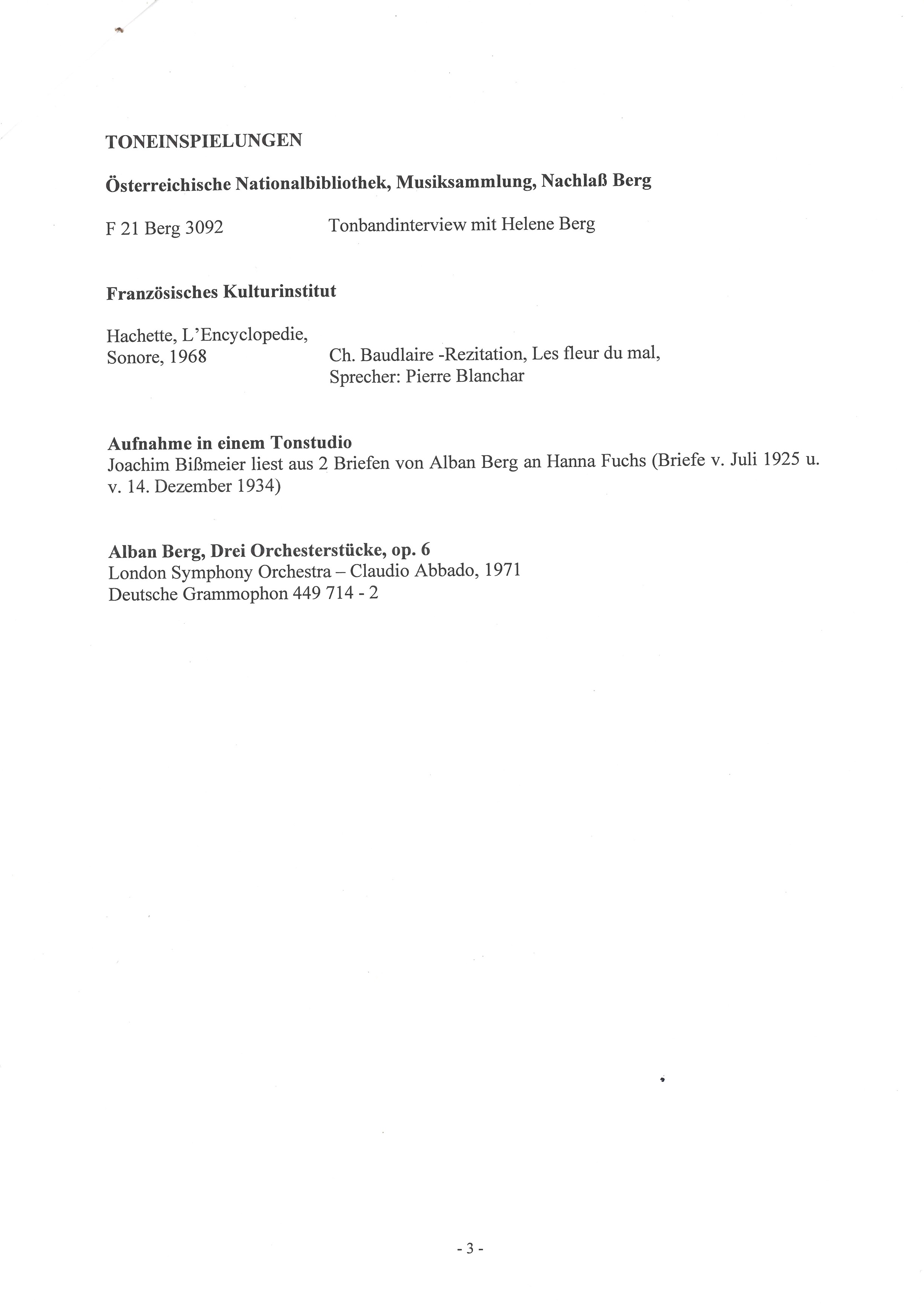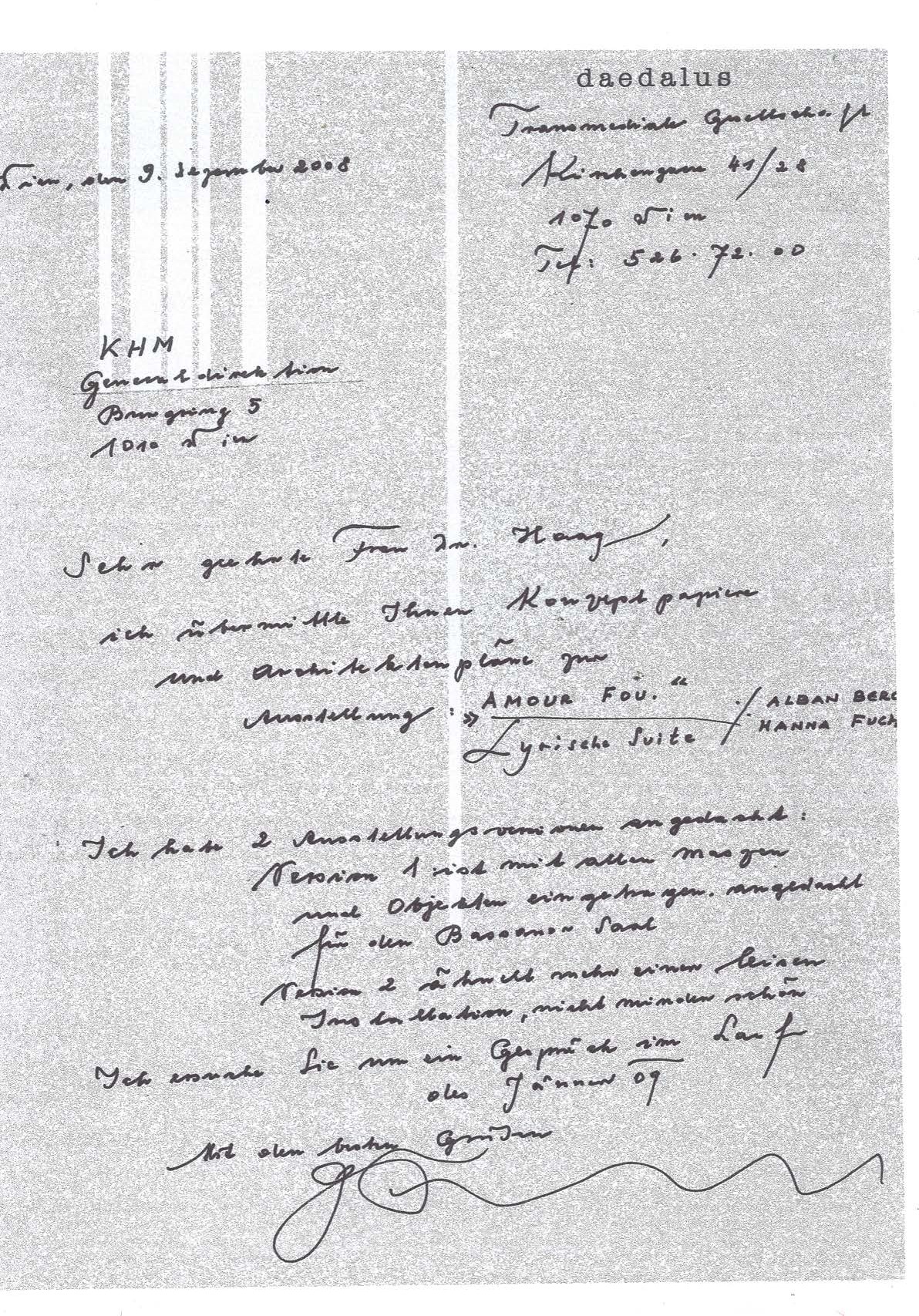Gerhard Fischer
AMOUR FOU
HANNA FUCHS, ALBAN BERG UND EIN STREICHQUARTETT, GENANNT LYRISCHE SUITE
Man sagt, Liebe macht blind;[1] sie macht mehr als das, sie macht taub, sie macht lahm; der, der daran leidet, der ist die Pflanze Mimosa, die sich schließt, und kein Dietrich öffnet sie, je mehr man Gewalt braucht, desto mehr schließt sie sich.
Søren Kierkegaard. Erstes Berliner Tagebuch 1841/42 [2]
Typoskript Herbst 2001, Winter 2008
Folgt man den Verlaufspuren der Liebesbeziehung Alban Bergs[3] zu Hanna Werfel Fuchs-Robettin,[4] die im Jahre 1925 beginnen und 10 Jahre bis zu seinem Tod andauern sollte, stößt man auf ein verbliebenes Briefkonvolut,[5] 14 Schriftstücke umfassend. Berg liebt Hanna Fuchs wegen dem, was sie in ihm auslösen wird, an Echos eines Anderswo, an Faszinationskräften, an Gefahren, die eine solche Leidenschaft mit sich bringen kann. Die Briefe stellen kleine brüchige Liebesutopien dar, dabei steht das Aufbrechen der Ich-Grenzen nach und nach im Zeichen der Katastrophe. In diesem Verlust seines Selbst verharrt Berg auf der Schwelle zur Sprache, der Körper begibt sich in den Zustand der Sprache. Die Melodie, der Sog dieser durch scheinbar nichts aus dem Fluss zu bringenden Sprache beeindruckt. Komponieren,[6] Schreiben.[7] Berg begehrt un ablässig bald das eine, bald das andere, eben deshalb verdient die schriftstellerische[8] Dimension eine höhere Beachtung als ihr bislang zuteil geworden ist. Der Schreib prozess ist immens, es wimmelt von Briefen an Arnold Schönberg,[9] Anton Webern,[10] Soma Morgenstern[11] und an Helene,[12] die Ehefrau Bergs.
Die künstlerische Praxis ist immer an den Körper, an dessen erotische Dimension, also von der Hand hervorgebrachte Musik, Graphie oder Schrift gebunden. Das Hin und Her der Hand bedarf der Blei- und Buntstifte, des Radiergummis und immer wieder des Bleistiftspitzers.[13] Die flattrigen Zeilen, die der Betrachter vor Augen hat, entfalten sich wie japanische Wasserblumen aus Papier. Die gelb-weißen Papierstücke - verfaßt im Zeitraum 1925-1934 - sind durchgehend mit Bleistift, einmal ein Notenblatt und einmal ein Papierbogen mit Tinte beschrieben: Einfügungen, Durchgestrichenes, Unterstriche nes, an den Rand Geschriebenes, Hervorgehobenes, Gedankenstriche skandieren die kleinformatigen Papiere. Die Berg'sche Zwiegesichtigkeit - manische Emphase und melancholische Entrückung - durchzieht wechselweise das Briefkonvolut. Die Schreiben an Hanna Fuchs sind fast ganz in diesem wie verhalten pathetisch schwingenden Stil geschrieben, noch im Kleinsten mit dieser wunderbar großen Gebärde eines Fiebernden. Stakkatohaft blitzt Liebessehnen auf, vibriert allein wie der aus einer Melodie herausgelöste Ton - oder wiederholt sich bis zum Überdruß wie das Motiv einer in sich kreisenden Musik. (Keine Logik hält das Begehren zusammen, die Stimmen ereifern sich, sie prallen aufeinander, beruhigen sich, kehren wieder, entfernen sich ohne größere Ordnung als die eines Mückenschwarms.)
Das dauernde Hinübergezogenwerden zu diesem bewunderten Geschöpf Hanna, die zu besitzen Berg mit dem unmöglichen Glück des einsamen Kindes begehrte, hatte weder einen Halt, noch gab es in jahrelanger Ausbreitung der Verführung einen beglückenden Fortschritt. In seiner Suche nach dem immer sich Entziehenden, Entfliehenden, ist Berg nach und nach einem Taumel nahe gekommen, und nur folgerichtig liegen auf dem Weg dorthin überall die Splitter der Begierde verstreut. Der Schreibakt an Hanna konstituiert dieses konstante Netz der Leidenschaft, in der Schreibzeit tauchen die Tumulte des Körpers auf und unter. Bergs Liebes-Leiden ist ausufernd wie der Nil, und die innere Unruhe ließ ihn nicht lange am Leben. Nicht ganz zu Unrecht fürchtete er, ohne ein Leben mit Hanna lebendig begraben zu sein.[14]
Im Mai des Jahres 1925[15] sind Alban Berg und Hanna Fuchs einander in Prag begeg net. Im Rahmen des Festivals der internationalen Gesellschaft für neue Musik wird der Komponist in der Stadt an der Moldau „Drei Bruchstücke für Gesang und Orchester aus der Oper Wozzeck"[16] unter der Leitung von Alexander Zemlinsky[17] zur Aufführung brin gen. Einer Einladung [18] folgend, nimmt Alban Berg in der noblen Villa der Familie Fuchs Robettin Quartier. Hell und warm ist der Lichteinfall im Haus Prag Bubenec No. 593, als es Alban Berg am 14. Mai betreten und am 21 Mai wieder verlassen[19] wird. Alles Sehen, Hören, Fühlen ist verwandelt. Die Ereignisse überfielen ihn und er stand unter dem Zauber der gleichzeitig unschuldigen und wollüstigen Halluzination. In acht Tagen lebte er ein ganzes Leben: ,,Keinen Moment kann ich vergessen, daß das Glück dieser acht Tage das Unglück der folgenden acht Jahre aufwiegt, und daß diese acht Tage erlebt zu haben mein ganzes Menschenleben wert ist."[20] Mit nachtwandlerischer Benommenheit wird Alban Berg im Juli 1925 den ersten 23 Seiten[21] langen Liebesbrief an Hanna Fuchs übermitteln, in dem die Erinnerungsschatten an den Prager Besuch herumgeistern; über einen Zeitraum von neun Jahren werden weitere Briefe als „Lebens- und Liebeszeichen"[22] an Hanna folgen - die letzten Passagen im Winter 1934, sind der zu Papier sublimierte Schrei.
Während die Eisenbahn oder die Elektrische mit bestimmten wackeligen Schriftzeilen in Beziehung gebracht werden kann, verfaßt Berg in aller Eile an Hanna Briefe in seiner Wiener Wohnung, im Cafehaus oder im Hotelzimmer in Prag: [6. 7. Nov. 1926]:[23] „Jetzt gegen 3 Uhr selbst heimgekehrt sitz' ich im Elend des einsamen Hotelzimmers, trinke den Cognac (... ) und wandere weiter - weiter durch diese Nacht - - - - welche Nacht - welche Nacht des Wahnsinns". [Nach dem 11. und vor dem 23 Juli 1925]. ,,ich schreibe diese Zeilen in einem Eisenbahnzug (daher die wacklige Schrift!) und sehe draußen wogende Felder im Sonnenglast vorbeifliegen, die eingerahmt sind von breiten Streifen wilden Mohnes - - aber wie verblaßt dieses liebliche Bild, wenn ich an Deinen himmlischen Mund denke." ,,[7].6. [1928] im Zug, wo ich Dir, Hanna, wie nirgends sonst, ungestört schreiben kann". ,,Natürlich:[23].1O." [1926]: ,,Zwei Stunden hab' ich Zeit für diesen Brief, den ich Dir, meine Hanna, durch einen Glücksfall übermitteln kann. Durch den Glücksfall: Alma, der ja immer einer ist und für alle, die mit ihr zu tun haben, wie erst für uns beide (... ) Gestern hörte ich von ihr, dass sie nach Prag fährt (... ), es ist also gerade noch Zeit ein wenig zu schreiben und hoffentlich Gelegenheit Alma [Mahler Werfel] oder Franz [Wertei] den Brief zuzustecken."[24] „11.5. [1928]: Freitag abends, ich sitze in einem Ringstraßenkaffee und blicke auf die Fenster Deines Hotels. Sie sind finster. Ihr seid also schon abgereist. Um meine letzte Hoffnung, einen von niemand gesehenem Blick mit Dir zu wechseln, wenn Ihr ins Auto steigt, mißlang. Mißlang wie der letzte Versuch, telefonisch ein von niemand gehörtes Wort Dir zu sagen." Er liebte mit solcher Kraft und solcher Naivität, dass er all die unschuldigen Zweifel erlitt, die uns bestürmen, wenn wir zum erstenmal lieben. ,,Wie dank' ich Dir, daß Du es doch immer wieder ermöglichst, daß wir uns sehen, und wie bitte ich Dich darum, es immer wieder zu ermöglichen, indem Du nach Wien kommst."[25]
Alban Berg bezeichnete die Schreiben an Hanna einmal als „lose, hingeworfene Blätter",[26] ohne Zusammenhang, wie es gerade die Stunde der Verzweiflung ergab: ,,Ich bin ein in stetem Herzklopfen dahintorkelnder Wahnsinniger geworden, dem alles, alles, was ihn früher bewegte (Freude oder Schmerz bereitete): von den materiellsten Dingen bis zu den Geistigen vollständig gleichgültig, unerklärlich, ja verhasst geworden ist. Der Gedanke an meine Musik ist mir eben so lästig und lächerlich, als jeder Bissen Nah rung, den ich gezwungen bin hinunterzuwürgen. Nur ein Gedanke, nur ein Trieb, nur eine Sehnsucht beseelt mich: das bist Du!"[27] Man spürt das Blut hämmern, das Herz schwimmt auf und ab. Das Zusammenprallen zweier Körper, die nicht hätten ange nähert werden dürfen, jeder ist durch den Anderen wie umgewendet.
Da ist im Mai 1925 das Verschmelzen der beiden am „Wald-Weg im Stern-Park"[28] „die Fahrten im Auto"[29] in der Prager Umgebung, ,,das Konzert im Smetana-Saal",[30] „dieWozzeck -Generalprobe im verdunkelten Theater"[31], „die heiligsten - die ganz ganz großen Ewigkeitsmomente in der Bibliothek"[32] im Hause Fuchs-Robettin: ,,die Seligkeit, in die Du mich versetztest als Du Deine Hände - diese, diese Hände - - an meine Wangen legtest - - - Oder, als Du sagtest: ,Nun kann ich Dich wenigstens ruhig anschauen."'[33] langsame Gebärdenspiele, die kurzen, ungreifbaren Augenblicke. Da ist der lange Abschiedsblick im Schatten des Haustores in Prag-Bubenec No. 593: ,,diese Augen, dieser Blick - - wer könnte Worte dafür finden: dieser Dichter ist noch nicht geboren - - Ja, können Töne dies ausdrücken??"[34] Die Reglosigkeit eines Augenpaares. Augenkollision, Augenflimmern. Minutenlang mit angehaltenem Atem sieht er Hannas Augen mit Wimpernkrone: ,,Blicke, in denen Liebeslust und -Leid eingefangen ist, wie sie noch nie auf Erden erlebt wurde."[35]
Berg begehrt Hannas „himmlischen Mund",[36] Hannas Gang, ,,in dem neben den geruhigen Rhythmus des Schreitens, ein zweiter, ein himmlischer mitschwingt."[37] Berg verlangt nach Hannas „plötzlich wie eine kleine Welle aufspritzenden Lachens (in ganz kurzen Tönen eines aufsteigenden Vierklangs)."[38] Berg beschwört das „Plissee"[39] eines „zuletzt angehabten Kleides"[40] und das unvollkommen Bedeckte, Hannas Achselhöhlen: „der Gedanke an die Möglichkeit, daß Dir andere Männer den ,Hof machen' könnten (... ), versetzt mich in wildeste Raserei. Und gar erst - - daß Du mit anderen tanzen könntest (... ) Und - wenn Du in Abendkleidern bist - -, gebe nie die Arme und gönne niemandem anderen den wahnsinnig berauschenden Blick in die schwüle und süße Heimlichkeit Deiner Achselhöhlen."[41] Berg bejubelt Hannas bourgeoise Stofflichkeit und der Schock einer solchen Erfüllung wirft ihn nach vor: ,,Wie sehr ich an Dir die Art liebe Deiner Lebensführung: die Leichtigkeit darin, ohne alle Pedanterie, die Beweglichkeit in der Lebensweise des Alltags, die natürliche Eleganz und Anmuth in Deiner Kleidung, die ohne jede Ziererei die höchste Stufe der Vornehmheit erreicht; die Art, wie Du diese erotische, laszive Mode in dezente Noblesse umsetzt - ohne dabei auch nur etwas von ihren Schönheitsmöglichkeiten zu opfern."[42] Hanna zu lieben und sich über ihre Natur in die Ausschweifung führen zu lassen: Bergs Hartnäckigkeit ist nichts anderes, als die Verteidigung des lmaginariums: ,,(... ) (o, laß mir den Wahn, daß wir uns trotz Getrennt sein bis an unser Ende, ,besitzen'!) (... ) Wie es auch sei und was noch Scheußliches kommen möge - - : eins steht unverrückbar fest für alle Ewigkeit: die Treue, die mehr noch ist als alles Liebesglück und alles Liebesleid, so doch nicht ohne Glück verlaufen wäre: ohne das Glück nämlich, das ich bis gestern noch mit mir herumtrug: von Dir rückhaltlos geliebt zu werden, wenn dieses Glück auch nie in Erscheinung träte, sondern nur unsichtbar zwischen uns schwebte - - -"[43]
Bergs sprachlich inszenierte Erotik streift immer wieder den Blick: es ist das Auge, das triumphiert. Das Auge ist dort, wo die Liebe ist. ,,Ubi amor, ibi oculus" (Albert der Große): ,,(... ) daß wir uns immer wieder einmal sehen, und uns auch physisch vergewissern dürfen, von unserem untrennbaren Verbundensein - - und sei es auch nur durch einen um einen Grad stärkeren Händedruck - - durch ein Berühren - - des Randes - - unserer -- - Schuh - - - Sohlen. Denn auf den einen Blick der Augen, der mehr sagen könnte als alle Berührungen, mußten wir ja diesmal verzichten."[44]
(Am schönsten und seltensten sind violette Augen in Moscheen, weiß die arabische Literatur). ,,L'oeil ecoute" (,,das Auge lauscht") hatte schon Paul Claudel[45] seine Aufsätze zur Kunst überschrieben. Marcel Proust sprach von „einem Blick, der Leib und Seele dessen, was er anschaut, berühren, einfangen, mit sich forttragen möchte"[46] und im Paris der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts gerät der Akt des Sehens zu besessenen Versuchsreihen in den Künsten.[47] Halten wir einen Moment inne um dem Akt des Sehens einige Ausführungen zu widmen. Schriftsteller wie Michel Leiris,[48] Georges Bataille,[49] Robert Desnos, Ethnologen und Analytiker wie Marcel Griaule und Jacques Lacan[50] und Maler wie Max Ernst,[51] Pablo Picasso,[52] Victor Brauner,[53] Andre Masson und Alberto Giacometti[54] erkundeten in den Dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahr hunderts den in der „Augenhöhle des Schädels eingefassten Edelstein."[55] Im Jahre 1929 erschien jene legendäre Nummer von „Documents",[56] die um den Mythos des Auges kreist. Stiche von Jean lsidore Grandville stehen neben der Bilderwelt des Kinos und zeitgenössischen Dreigroschenromanen; Desnos, Griaule und Bataille stellen erhellende Aufsätze vor. Batailles[57] Text führt das Auge als „kannibalischen Lecker bissen" an. ,,Das Auge", schrieb er, ist eines der Dinge, ,,deren extreme Verlockung vermutlich an der Grenze zum Schrecken liegt". In dieser Hinsicht könnte das Auge in die Nähe von „scharfe Klinge" gerückt werden, deren Anblick ebenfalls heftige und widersprüchliche Reaktionen hervorruft. Zur Illustration dieser Ausführungen führt er die berühmte Szene des Films von Louis Bunuel „Un chien andalou"[58] (1929) vor, in der ein Rasiermesser in das strahlende Auge einer jungen und bezaubernden Frau schneidet. Bataille erläutert einerseits eine mögliche, drohende Organverletzung,[59] andererseits beschreibt er das Auge als Lanze, die sobald sie gezückt, zum Blick geworden ist, den durchbohrt, der einen seinerseits anblickt. In der Erzählung „Geschichte des Auges" wird Bataille das Bild des Auges und das Bild eines weiblichen Geschlechtsteiles vermengen. Hans Bellmer[60] illustrierte diese als lange anstößig geltende Schrift und zeichnete die Vulva als nach innen gestülpte und gefaltete Form eines Phallus, der sich jederseits nach außen wenden und sich aufrichten kann und darin der Struktur des umgekehrten Handschuhfingers gleicht, den Merleau-Ponty im Zusammenhang mit dem Blick erwähnt. Als passiver, weiblicher Behälter des Sichtbaren, als hohle Form, in der sich das Reale abbildet, ist das Sehen auch phallusartig und kann sich aus seinem Hohlraum nach außen entfalten, erheben und auf das Sichtbare[61] hinweisen. Der Blick ist die Erektion des Auges.
Berg macht aus jedem morphologischen Zug Hannas einen Gegenstand der Lust. Auf dem langen Weg der Annäherung an Hanna Fuchs spielt die Photographie in jedem Abschnitt eine bedeutende Rolle. Man betrachtet also so, wie man begehrt oder wie man phantasiert. Bergs Augen waren so empfindlich wie photographische Platten, und er wünscht sich Augen im Zustand der Lust, er möchte mit den Augen in Photographien von Hanna spazieren gehen, so kann er ungesehen seine Lippen auf die ihren legen:
,,Dann versprachst Du mir ja ganz offizielle Amateurphotographien von Euch Vieren ... Die muß ich kriegen. Ach ich bin ja so wahnsinnig gewesen, daß ich mir keine von Dir mitnahm. Jetzt erst sehe ich, was das für mich bedeutete!!! Und wie ich unsagbar leide, dass ich keine (und sei es die schlechteste!) von Dir habe!!".[62]
Hanna Fuchs drängt Alban Berg ins Maßlose, in ein maßloses Begehren, in eine maßlose Musik- und Spracharbeit: ,,Könnte ich Dir wenigstens alle Tage schreiben! Wie viel leichter wäre es, diese unbeschreiblich harte Trennung zu ertragen, wenn wir voneinander durch eine Art Tagebuch wüßten, das jeder von uns führte und das wir uns alle Wochen oder wenigstens alle Monate einmal zukommenlassen könnten. Denn was bedeutet schließlich das, was wir durch die offizielle Korrespondenz zwischen Dir und Helene (und wofür ich ja gewiss nicht undankbar bin) voneinander erfahren, im Vergleich zu dem, was wir wirklich erleben - im Vergleich (laß mich nur von mir schreiben:) zu der bis zum Wahnsinn erhitzten Phantasie, auf die ich in meinem Liebesleben - und das ist ja das einzige Leben, das ich noch lebe - angewiesen bin. Ja die Qual dieses auf allen Linien Entsagen-Müssens ist manchmal so fürchterlich, daß ich mich fast ängstige, Dich mir auch körperlich vorzustellen oder gar das einzige Bildchen, das ich von Dir geraubt habe, anzusehen. Und wenn ich mir vorstelle, daß ich Dich in ein paar Wochen vielleicht sehen werde, Dich schauen darf, Deine Hand küssen und drücken werde dürfen - - - so kann ich eigentlich nichts anderes glauben, als daß ich in diesem Augenblick vom Schlag gerührt umsinke."[63]
Doch wie begrenzt und doch unbegrenzt sind die Möglichkeiten, einander zu begegnen. Berg schmiedet „alle möglichen und unmöglichen Pläne[64]", um mit Hanna in Verbindung zu treten. Beim Telefonieren mit der Geliebten gerät Bergs „Herz, das zum Zerspringen Unruhige"[65] in Zuckungen. Was ist er anders als ein Klangsüchtiger, völlig berauscht von der Überwindung des Raumes und der Übermittlung von Hannas Stimme. Stimme ist wie Fett, das alles durchdringt, Stimme vermag den lauschenden in eine Verzückung oder wie Guillaume Apollinaire sagt, in eine akustische Halluzination[66] zu versetzen. Konstantin Kavafis (1863-1933) aus Alexandria verdanken wir ein meisterhaftes Poem über die Verzauberung, die Stimmen auszulösen vermögen.
Stimmen (1904)
Ideale und geliebte Stimmen derer
Die gestorben sind, oder derer
Die für uns verloren sind wie die Toten.
Oft sprechen sie in unseren Träumen,
Oft, im Gedanken versunken, hört sie der Geist.
Und mit ihrem Echo kehren für einen
Augenblick
Die Geräusche der Urdichtung
Unseres Lebens zurück
Wie Musik in der Nacht, die in der Ferne
Verklingt.[67]
Die Schreiben an Hanna werden der Raum des Triebs[68] und es sieht ganz so aus, als würde die silberne Bleistiftmine[69] Bergs jedesmal zwischen dem wunderbaren Leben und dem schrecklichen Tod zaudern. Die ganze Schreibfläche des einen bedeckt die ganze Körperfläche des anderen. Hanna genießt Bergs Gebärde des Verstreuens. Die Wonne läßt ihr Gesicht aufleuchten. Wie sollte man nicht Dankbarkeit empfinden, wenn man dergleichen Gaben erhält. Aber die Gabe darf den gierigen Augen der Welt nicht dargeboten werden. Annehmen bedeutet, dass die Begierde nicht enden wird. Um diese entfesseln zu können, schenkt Hanna Alban einen goldenen Füllhalter.[70] Berg hält bei seiner Arbeit das Instrument, das Linien und Farben setzt, das vom Raum und Material Besitz ergreift, so fest und so zart wie möglich in der Hand. Die königliche Eleganz des Füllhalters beschwört die Gefahr, sich im Nichts zu verlieren. ,,(... ) Daß ich in dem Moment, wo ich arbeitend Deine Füllfeder ergreife, bei mir, also bei Dir bin, ebenso wie ich, wenn ich im Gedanken bei Dir bin, bei mir bin."[71] Hat sich also Hanna Fuchs, indem sie Alban Berg verwandelte, selbst einen Gegenstand des Erstaunens schaffen wollen?
Bergs Ausweitung der Korrespondenz bis ins Jahr 1934 verknüpft sich früh mit der Demonstration einer musikalischen Textur für Hanna, gedacht als ein Bekenntnis eines „Liebe-Erlebens".[72] Die melancholische Selbstversunkenheit des Liebenden erschließt sich in einem Brief an Hanna vom Juli 1925, in dem Berg musikalische lntensitätsfiguren eines obsessiven lnneseins mit der Geliebten zu artikulieren beginnt, denn zu überleben hat das Werk, ein anderes Mittel hat er nicht.
„Wird es mir vergönnt sein, die Ruhe zu finden, in Tönen das auszudrücken, was ich in und seit diesen Tagen in P.B. [Prag Bubenec] erlebt habe? Heute könnte ich's noch nicht: ich kann keine Taste berühren, keine Notenzeile aufschreiben - so blutet ununterbrochen diese schwerste Wunde, die ich mit mir wohl zeitlebens herumtragen werde. Am liebsten schriebe ich Lieder. Aber wie könnte ich!: die Worte der Texte verrieten mich. So müssen es Lieder ohne Worte sein, in denen nur der Wissende - - nur du wirst lesen können. Vielleicht wird's ein Streichquartett.
Im Rahmen dieser vier Sätze soll sich alles abspielen, was ich seit dem Moment, wo ich euer Haus betrat, durchmachte. Von den, 1.- im matten, edlen Glanz der Beschau lichkeit in Eurer Mitte verlebten ersten Stunden und Tage und Abende, 2.- über die still und immer süßer keimende Liebe zu Dir 3.- über die beseligendste halbe Stunde und ganze Ewigkeit jenes Vormittags 4.- bis zu der dumpfen eisigen Nacht der Trennung des Alleinseins, der völligen Hoffnungslosigkeit, Entsagung und Öde. - Das wären vier Sätze! Wenn mir Gott die Kraft gibt, sie zu schreiben, so ist das ja auch nichts anderes, als ein Mittel, mich mit Dir in Verbindung zu setzen. Dann hätte meine Musik wenigstens einen Sinn.
Ich fand heute im Baudelaire[73] ein Gedicht, das so recht den Inhalt des letzten Satzes wiedergebe:
Zu Dir, Du einzig Teure, dringt mein SchreiAus tiefster Schlucht, darin mein Herz gefallen
Dort ist die Gegend tot, die Luft wie Blei
Und in dem Finstern Fluch und Schrecken wallen.
Sechs Monde steht die Sonne ohne Warm.
Im sechsten lagert Dunkel auf der Erde,
Sogar nicht das Polarland ist so arm
Nicht einmal Bach und Baum, noch Feld und Herde
Erreicht doch keine Schreckgeburt des Hirnes
Das kalte Grausen dieses Eis - - Gestirnes
Und dieser Nacht, ein Chaos riesengroß!
Ich neide des gemeinsten Tieres Los
Das tauchen kann in stumpfes Schlafes Schwindel! - -
So langsam rollt sich ab der Zeiten Spindel! -
(... ) Wenn Du diesen Brief (womöglich mehrmals) gelesen hast, verbrenne ihn und vernichte die Asche! Aber denke immer so an ihn, als stünden seine Worte vor Dir u. alles, was ich hineinlegen wollte, als schwaches Symbol meiner ewigen, unsterblichen Liebe. -"[74]
Am 13. Juli 1926 berichtet Berg schließlich seinem Lehrer Arnold Schönberg, daß er „mit großer Hast, ja
Nervosität, an einem Streichquartett arbeite, an mehreren Sätzen zugleich."[75] Wer in den Briefen Bergs weiterblättert, findet im Brief an Hanna
Fuchs vom 23. Oktober 1926 die Darlegung des Konstruktionsprinzips des Streichquartetts; in dem
magnetischen, streng organisierten Zwölfton-Stück, das nur unter geheim zu haltenden Qualen zustande kam,
konnte Berg Hanna sein Eigentliches enthüllen:
„Eine andere vague [sic] Hoffnung für die Zukunft: die 10.
Aufführung des Wozzeckin Prag, wenn es zu der überhaupt kommt!
Noch eine andere: die Aufführung des
Quartetts in Prag, das ich (noch darf es niemand wissen!) Zemlinsky ,widme'. (Obwohl es Dir gehört!). Aber
die Aussicht, daß ich zu so einer Kleinigkeit nach Prag reise, ist eigentlich gleich Null. Und so bliebe
davon nur meine geistige Gegenwart, wenn es zum ersten Mal Deinen Ohren erklingt. Wird die Musik, trotz
aller Modernität so stark sein, daß sie zu Dir dennoch spricht und so stark und eindeutig spricht als sie
gedacht ist. Gedacht als ein Bekenntnis (das aber niemand was angeht, als Dich!) unseren Liebe-Erlebens! Vom
Beginn meines im Mai 1925 nach Prag Kommens: dem ersten Satz, einem Allegretto gioviale mit seinem fast
unverbindlichen, freundlichen Einleitungscharakter. Freilich ist dieser Satz schon, wie das ganze Werk (ich
nenne es Lyrische suite, da von all dem noch niemand etwas weiß, darfst Du das natürlich offiziell
auch nicht wissen. Um Gottes willen ,versprich' Dich daher diesbezüglich nicht! Nicht einmal der Titel ist
bekannt!) voll von geheimen Beziehungen unserer Zahlen 10 und 23 und unserer Anfangsbuchstaben H F A B (die
ja, verschlungen, auch die Anfangs- und Endtöne des Tristan[76]-Themas sind.)
Aber schon der II. Satz spricht eine andere Sprache, das Andante amoroso (eine Musik, die, glaube ich, die schönste ist, die ich je schrieb) zeigt Dich und Deine süßen Kinder in drei Themen, die rondoartig immer wiederkehren. Wenn gegen Schluß das Deine, das Schönste, Wärmste und Innigste, über den zwei andern, dem etwas slawisch angehauchten Munzos und dem ostinaten zum letzten Mal erstrahlt, muß, glaub' ich, auch ein ahnungsloser Hörer etwas von der Lieblichkeit verspüren, die mir vorschwebte und mir immer vorschwebt, wenn ich an Dich, Lieblichste, denke.
Der III. Satz, Allegro misterioso, schildert das anfangs Ahnungslose, Geheimnisvolle, das Flüsternde unseres Beisammenseins, in das, als Trio extatico der erste kurze Liebesausbruch eingebettet ist, das dann auch im IV. Satz, dem Adagio affettuoso, zugrundeliegt. Hier erst entfaltet sich das dort und wie ein Blitz einschlagende Liebesbewußtsein zur großen unendlichen Liebesleidenschaft. Die zuerst von mir überschwänglich gesprochenen Worte, Du bist mein Eigen, mein Eigen!' (aus Zemlinskys ,Lyrischer Symphonie'[77] notengetreu zitiert) wiederholst Du in süßer, ganz verhaltener Verträumtheit.
Aus diesem, kurzen, Glück reißt Einen das Presto delirando des folgenden Satzes (V.) mit seinen jagenden Pulsen, seinem in die schale Dumpfheit der Nächte immer wieder hineinplatzenden Delirium, um schließlich im letzten Satz, Largo desolato (VI.), den Höhepunkt der Verzweiflung und Trostlosigkeit zu finden.
Ja bei Gott:
,Erreicht doch keine Schreckgeburt des Hirnes
das kalte Grauen dieses
Eis-Gestirns
und diese(r) Nacht - ein Chaos riesengroß !'
Wird jemand außer Dir ahnen, was diese Töne, welche vier einfache Instrumente so vor sich hin spielen, zu sagen haben? Wird man, wenn sie am Schluß nacheinander aussetzen und ganz verlöschen, die unendliche Traurigkeit verspüren, die jenem kurzen Glück gefolgt ist, das , - - - so Iangsam rollt sich ab der Zeiten Spindel ' ? Wenn Du es, meine Hanna, nur spürst! Dann ist es nicht umsonst geschrieben. Wenn Du nur, meine Hanna, spürst wie ich Dich liebe; dann hat nicht umsonst geliebt Dein Alban."
Nach der im Januar des Jahres 1927 erfolgten Uraufführung[78] der „Lyrischen Suite"[79] durch das Wiener Streichquartett Rudolf Kolisch,[80] folgt ein Reigen von weiteren Aufführungen[81] in europäischen Städten in den Jahren 1927 bis 1931. Der rapide Erfolg erregt den Komponisten, ein narzisstischer Wunsch nach Ruhm ist unverkennbar. Beglückt empfängt Alban Berg am 13. Dezember 1927 aus der Feder Soma Morgen sterns einen Bericht über die Aufführung der „Lyrischen Suite" in Berlin durch das Kolisch Quartett.[82] Blicken wir in das Jahr 1928. Um ein „paar Stunden im Jahr"[83] mit Alban zusammen zu kommen trifft Hanna Fuchs im Wonnemonat Mai in Wien ein, um in Gegenwart des Geliebten einer Aufführung der „Lyrischen Suite" beizuwohnen. Wie beglückend können Konzertabende im Dunkel sein! Berg dankt in einem Brief für das Beisammensein, wo er sich mit Hanna „eins wähnte wie nur Menschen eins sein können (... )Man sagt, man könne sich Liebe und Leid von der Seele wegschreiben. Mir scheint: mit der Lyrischen Suite (die Du nun gottlob, gottlob! gehört hast und in meiner Gegenwart!) hab' ich diese Gefühle Dir von der Seele weggeschrieben."[84]
Als gelte es, dieser Musik den schmerzlich widerständigen Puls zu fühlen, lässt Alban Berg Hanna im Juni 1928 den „einzigen Brief, der Sinn hat"[85] übermitteln, denn er weiß, dass ein Brief „nur ein Tropfen im Meer"[86] der „Liebe ist." Dem Brief vom 7. Juni 1928 ist eine kostbareGabebeigefügt: die mit Eintragungen Bergs versehene Taschen partitur der „Lyrischen Suite": ,,Der Glücksfall, dass ich Dir durch A [Alma] oder Franz [Werfel] schreibe, tritt ja immer seltener ein. Ja du bist noch nicht einmal im Besitz des einzigen Briefs, der Sinn hat, des dir geweihten Exemplars der Lyrischen Suite. Aber jetzt wird es Dir Franz wohl mitbringen, zugleich mit diesem Brief und einem Dir in der Stunde Deiner Abreise von Wien geschriebenen."[87] In der Qual und der Freude seiner Arbeit an dem Ton- und Buchstabenkunstwerk hielt er immer wieder inne, am liebsten hätte er vielleicht auf Gazellenleder geschrieben und die Gabe in einer Bambusrolle übersandt. Von einer Art Rausch erfasst, wird Hanna Fuchs das Liebes objekt bis an ihr Ende hüten, allein darum besorgt, die Gabe wachsen zu lassen.
Die Widmungspartitur,[88] dieser schmale Noten-Band, dokumentiert das ,desir d'ecrire',das Begehren zu schreiben' (Roland Barthes). Aus den Abgründen des Begehrens bringt Berg ganz kleine oder große Textinseln, Buchstaben und Satzsplitter mit. Die Fläche, auf der sich Bergs Sprache entfaltet, ist die Partitur des Erstdruckes[89] (1927) der „Lyrischen Suite". Der Band besteht inklusive des Porträtfotos, der Titelseite, der Vorrede von Erwin Stein und der Widmung ,FÜR MEINE HANNA', aus [90] Seiten. Die Sorgfalt, die Berg darauf verwendet, der Geliebten die Konfiguration der ,Lyrischen Suite' zu erklären, zeigt den Eifer eines Besessenen. Berg benutzte drei verschiedene Stifte und Tinten, hauptsächlich rot, manchmal blau, und nur im II. und VI. Satz wird auch grün verwendet. Berg verfügt über die beneidenswerte Gabe des koloristischen Ausdrucks und erhebt die Taschenpartitur zum bunt schillernden Paradiesvogel. Der Band wird über weite Strecken zu einem Seherlebnis, das Geist, Emotion und ästhetische Empfindungen zu gleichen Teilen anregt. Auch in den Skizzengruppen[90] der „Lyrischen Suite" verwendete Berg stupend eine Vielzahl von Stiften und Tinten, um die verschiedenen Variationen der Ton-Reihe zu verdeutlichen.
Der vollständige Autograph[91] - ausgeführt mit Bleistift auf 14-linigen Notenpapieren - ist die früheste Niederschrift der Quartettsuite. Polychrome Explosionen in grün, rot und blau sind unter das Graphit des Bleistifts gemischt und markieren den Wuchs des Zwölfton-Werkes. Rot explodiert und verzehrt sich selbst. Blau ist unendlich. Grün kleidet die Erde in Stille, verebbt und flutet mit den Jahreszeiten. In ihm liegt die Hoffnung auf Auferstehung.
Bergs Partiturblätter der „Lyrischen Suite" sind auslotende und ausfällige Vorstöße in alle Richtungen der Zwölftonreihe.[92] Bergs Bleistift, der sich reiben, schärfen, feilen und verschleifen läßt, besiedelt die Papiere: Noten neben Noten mit langen Notenhälsen. Hälse voller Liebesgeflüster wie auf Köpfen veronesischer Meister: Silbergraue Ellipsen beginnen sich auf sandfarbigen Notenbögen niederzulassen. Beim Durchblättern des Notenhaufens fallen die Wechselbeziehungen sich überlagernder, divergierender und kohärenter Strukturen ins Auge. Berg setzt bei der genialen Bastelei an der „Lyrischen Suite"[93] suggestive Graphen aufs Papier. Verworfenes geht in Flammen auf, denn das Reich der Leidenschaft kümmert sich wenig um Konventionen. Die Strichführung scheint mit verbundenen Augen ausgeführt - einzig das Begehren treibt die Hand, die Hannas und Albans Geschichte in Ton-Tropfen verwandelt.
Die Lyrische Suite empfing ihre Nahrung auch aus der geographischen und kosmischen Position, in die Berg aufgebrochen war. Die Notation der Quartettsuite erfolgte in der Einsiedelei, in Trahütten[94] gelegen in 1000 m Seehöhe am Fuße der Koralpe. Den ersten Satz beendet Alban Berg im Herbst des Jahres 1925, und der Schreibtrieb wuchs über den Winter in das Sommergrün hinein - der zweite Satz ist mit 12. Juni 1926 datiert. Lehmgrün ist die Luft, als Berg Ende September 1926 den sechsten Satz des Quartettes zu Ende führt.
Das Auge des Betrachters genießt das Gewimmel der Farbstifttupfer im Bleistiftgebiet. Farbe[95] ist gewöhnlich der Ort des Triebs, denn Farben wollen die Erregung unterbrin gen. Wie in Atlanten auf den Vulkankarten die Angabe glühendheißer Zonen fasziniert, taucht inmitten der Wellenbewegung ein Geschmier auf. Das Auge entziffert[96] das eingeschriebene Baudelaire Gedicht „De profundis clamavi" nur allmählich. Vers und Ton: Baudelaire und Berg, der Dichter und der Musiker, sie waren wie zwei Bäche, die zusammentrafen, um einen dritten zu bilden.
Der Farbstoff, den Berg ein Jahr am Notenpapier aufgehäuft hat, das Grau-Schwarz des Bleistifts, wird mit all der Magie, die Buntstifte ausüben, immer wieder vermengt. Nahe einer Kohlezeichnung ist der 57-seitige Autograph der Partitur der „Lyrischen Suite" ein Schlingwerk; es sind nicht so sehr die Tonfolgen, die an der ästhetischen Besonderheit der Komposition imponieren, als die von der Hand Bergs hinterlassenen Graphen: Da ist ein gewisser Zug zur Kalligraphie, die auch andere Partituren auszeichnet.
Die Mine des Bleistifts entstammt der Erde, Farbe führt zu allererst nach unten, weit unter das Sichtbare. Mit all dieser Alchimie der Tiefe[97] ist der Schreibakt Bergs verknüpft.
In der Widmungspartitur begibt sich Bergs Körper in den Zustand der Sprache, quasi parlando. Eine Rede, die strömt, eingeschlossen in visuelle Kontraste, damit sie aufgrund der ihr eigenen Leuchtkraft das Werk erschließt. Notizen und Partitur bilden somit eine einzigartige, gedrängte, kohärente Figur. Worte werden an die Noten direkt angeheftet oder eher noch gehen sie aus ihnen hervor, im Gleiten der Worte, die die Noten anstecken, oder einen Stoß auslösen, erreicht Schreiben eine Schneeflocken bewegung. Bergs Worte tauchen in die kleinsten musikalischen Vibrationen. Schreiben ist da, um ein paar Spuren dessen aufzusammeln, was sich unerbittlich zersetzt, halb verwischte Abdrücke dessen, was war und was so niemals mehr in der Vollständigkeit derabsoIuten Liebewiederherstellbar sein wird.
Der Band, dieses lange Gedicht des Begehrens und der Verzweiflung, tragisch und fröhlich in seinem Raunen und in seinem Murmeln, durchsetzt von Schmerz wie auf manchen Bildern von Nicolas de Stael,[98] wenn die Farben verlöschen und von unbe stimmten Abgründen angezogen zu werden scheinen. Der Künstler als exemplarisch Fallender. Eine verschlüsselte Suche nach der Liebe, wo der Körper die Hauptrolle spielt, die er anschließend der Seele zurückgibt, und wo alles sich nur im stummen Lauf der Zeichen und in diesem Zirkulieren des Begehrens erklärt, auf diese Weise eine wahrhaftige Metaphysik der Liebe begründet. Bergs polyphoner Text, in feingliedriger Schrift verfaßt, läßt sich als eine Vielzahl von Subtexten lesen, die sich gleichsam über die musikalische Textur stülpen; der Einsatz der Farbtinten wirkt melodiös, die graphischen Pole haben die Länge und den Elan der Linie und lassen die thematischen Netze und Obsessionen besser modellieren.
Wie ein Stoffgewebe aus Ketten- und Einschlagfäden besteht, so besteht die Wid mungspartitur aus horizontalen und vertikalen Linien; vermengt mit verbalen Flecken und Adern, so daß alles zusammengehört und einem weichen Gewebe gleicht, bei dem alle Fäden an ihrem Platz sind wie bei feiner Seide. Die Farbtusche ist ein Fluß durch Schwarz-Weiß und für Stimmung und Atmosphäre geeignet, auch hinterläßt sie eine mildernde Wirkung des Gedruckten. Wenn die Feder das Papier berührt, gibt es nur noch Unterschiede des Druckes, der Geschwindigkeit, des Winkels und der Richtung. Beim Schreiben wird die Feder vom Daumen und von den Fingern gelenkt, die Schreib bewegung hängt von der Tusche und ihrer dünnen, dicken oder verhältnismäßig feuchten Beschaffenheit und von der Art der Papieroberfläche ab. Somit ist es das Zusammentreffen zweier verschiedenartiger Faktoren, das die Schnelligkeit und Flüssig keit der Bewegung bestimmt oder ihr genaues Gegenteil. Zwischen Schrifttext und musikalischem Text entsteht eine optische wie akustische Brechung, die vielfache Echoeffekte und damit ein textiles Geflecht erzeugt. Die Sprache ist einer Syntax unterworfen, die Töne mathematischen Zusammenhängen, die Farben chromatischen Zusammensetzungen. Denn die Kunst ist ja nichts anderes als das Ausnützen der Stofflichkeit der Mittel, um Ausdruck herauszuholen.
Wenn Berg aus freien Stücken gesagt hat, daß es etwas Geheimes (und von der Forschung lange Ungedeutetes) in der Partitur gäbe, so waren es die Initialen der Namen Hanna Fuchs (H + F) und Alban Berg (A + B), um die die Lyrische Suite in den Haupttönen zentrifugal kreist. Es galt, ,,in dieser Musik immer wieder unsere Buchstaben H, F und A, B hineinzugeheimnissen; jeden Satz und Satzteil in Beziehung zu unseren Zahlen 10 + 23 zu bringen. Ich habe dies und vieles andere Beziehungsvolle für Dich (für die allein - trotz anstähender (sic) offizieller Widmung - ja jede Note dieses Werks geschrieben ist) in diese Partitur hineingeschrieben. Möge sie so ein kleines Denkmal sein einer großen Liebe".[99] Behutsam beginnt Berg die Lektüre der „Lyrischen Suite" anzuleiten, um die tiefer liegenden, verborgenen thematischen Netze zu erhellen. Mit der Anstiftung zur Lektüre muß Hannas Enthusiasmus entfacht werden, ohne den die Kunst nichts wert ist. Nicht in erster, naiver schneller Lektüre, sondern nur in innehaltender kann Hanna die Tonfolge des Werkes studieren, um die Polyphonie zu durchschauen. Lesen reizt zum Vor und Zurücktasten, zum Auffalten der Mehrdimen sionalität, der Zeichenhaftigkeit von Sprache und Musik. Derart ist tendenziell in der Lektüre eine Punktualität der Vertiefungen angelegt.
Auch der eigene Körper - der unentwegt zwischen Schwingungen der Lust und des Schmerzes schwankt - wird ausgelotet. Eine Beziehung zu dem Es seines Körpers wählt Berg mit dem Porträtfoto, den gedruckten Namen in der Widmungspartitur überdeckend, schrieb Berg mit roter Tinte „Alban". Gegenüber dem Foto, auf der Titelseite setzt er oben die Widmung „FÜR MEINE HANNA" - jeder Buchstabe ist hier ein kleines Wesen, das graphische Spiel der Buchstaben - ausgestreut im Partiturraum - kann beginnen.
Für die Taschenpartitur benötigt Berg ein Foto, aber nicht irgendeines, sondern ein ganz ideales.[100] In einem verbliebenen, umfangreichen Fotokonvolut[101] findet sich dieses Foto, das er am meisten geschätzt haben muß, und das er als Stichvorlage für die Taschenpartitur herangezogen hatte, damit dieses Hannas Auge stimulieren könne.
Jede individuelle Geschichte wird durch ihre photographische Geschichte verdoppelt. Man erkennt auf Fotos das Größerwerden des Körpers. Von Kinderphotos [102] bis zu einem Photo in unmittelbarer Nähe knapp vor seinem Tod[103] im Jahre 1935 spannt sich der Bogen der Berg-Portraits.
Berg war ein begehrtes Objekt von Photographen.[104] Die Beschlagnahme des Körpers durch die Kunst-Fotographie passiert in monochromen Farben. Die Aufnahmen - zumeist in der Wohnung, Wien XIII., Trauttmansdorffgasse 27[105]oder auf den Land sitzen ausgeführt - sind einerseits durch die Suche der photographischen Vollendung der Position gekennzeichnet, andererseits dokumentieren sie das Momentane in der Haltung des Portraitierten und die Physiognomie der anwesenden Gegenstände der Zeit. Dem meist Sitzenden dienen Fauteuille, Schreibtisch und das Bösendorfer Klavier als Stützfläche. Ins Auge fallen der Bleistiftspitzerapparat und die mondäne Füllfeder Hannas.
Bemerkenswert sind die extravaganten Mäntel[106] und Anzüge[107] Bergs, die perlweißen Hemden, die Stecktüchlein,[108] der straffe Kravattenknoten, die Verschlaufungen der Fliege.[109] Das Haar ist gescheitelt, manchmal schmückt den Schüchternen eine dunkle Hornbrille. Manche Fotos decken auch bestimmte intime Stellen des Körpers auf: Da ist die unverkennbare Luke zwischen den Schneidezähnen.[110] Immer wieder fällt die brennende Zigarette auf, die zwischen den Fingern oder auch im Mund balanciert wird. Betont eine Vielzahl der Fotos in rotbraun und gelbgrau die melancholische Eleganz des Komponisten, so geben die spontanen Stimmungsfotos in schwarz-weiß Alltagsbilder wieder. Fasziniert bestaunt man die Schnappschüsse vom Leben auf dem lande. Es war die Zeit der Sommerfrische, in der sich die Elite während der heißen Sommer monate in ein großzügiges, schattiges Landhaus[111] zurückzog. Speck, Gans mit Rot kraut, Zeller mit Sauce hollandaise, Erdäpfelpürree und Milchrahmstrudel waren die Gaumenfreuden, die das Land bescherte. Berg entwickelte über die Jahre eine intensive Beziehung zu den Landschaften Kärntens und der Steiermark, alles tönende und farbige der Natur wirkte ganz direkt auf ihn ein. Für die Präzisionsbesessenheit waren Zurückgezogenheit und Stille nachgerade lebenswichtig. Auf seinen Wanderungen[112] streift er Blütentrauben und erinnert sich an die ätherischen Festen der Alpen bei Giovanni Segantini,[113] dessen Aufzeichnungen den jungen Komponisten beflügelten, betonen sie doch die metaphorischen Verbindungen von Blüten[114] und Liebe.
Blüten und Pflanzen versetzten Alban Berg immer wieder in Taumel und Wollust, im Duft der Hyazinthen wird sein Herz am Ostersonntag 1923 schnell trunken: ,,(... ) Im Zimmer stand ein Riesen-Blumenkorb mit ca. 20-30 der herrlichsten Hyazinthen. (... ) Für mich war dieser Korb ein Labsal. Du ahnst nicht, wie es in dem Zimmer roch. Ich liebe diese Blumen so ungemein. Vielleicht, weil es die ersten richtigen Blumen sind, die das Frühjahr bringt."[115] In Träumen erblickt er „langgestreckt wellige Almwiesen mit dunkelblauen Vergißmeinnicht und schwarzen Kohlröschen und brennend roten Alpenrosen und Felsenabhängen mit grauen, zersplitterten Baumruinen und schwarzem Alpensalamander in weißem Geröll und Rudeln von Schneehühnern unter verkrüppelten Zwergkiefern. (... )"[116]
Wie Claude Monet seinen Seerosen-Teichen[117] nicht widerstehen konnte, wird Alban Berg in den letzten, einsamen Lebensjahren im „Waldhaus" in Auen am Wörther-See die Begierden eines Alpen-Gärtners entfalten. Und da gibt es noch einen Blumentraum, der die Neigung von Bergs Körper an der homoerotischen[118] Lust verrät. Ein Liebespaar ist auf einem blumenbestreuten Pfad unterwegs zu einem „Luftschiff", das „weit in den Himmel hinauf- ins Unendliche" stieg: ,,Heute nacht hatt' ich einen schönen Traum!! Ich besaß einen herrlich schönen, riesengroßen Hund, der aber so gefürchtet war, daß niemand sich an ihn herantraute; seine Augen hatten etwas so Rätselhaftes, sein Blick war so menschlich magnetisch, daß ich mich ganz in diesen Blick verliebte! Einst, als ich wieder allein mit ihm war und sich alle anderen Mitmenschen entfernt hatten, verwandelte sich dieser Hund in einen berückend liebreizenden Jüngling, der mich voll Zärtlichkeit umschlang und aufforderte, ihm zu folgen. So schritten wir denn, ver schlungen, er in göttlicher Nacktheit, ich in weitwallender, schwarzer Gewandung, den Menschen entgegen, die uns früher geflohen waren und die uns jetzt voll Freude und Begeisterung erwarteten. Als wir ihnen nahten, begannen sie zu jubeln und schwangen Palmenwedel und wiesen uns einen Weg, der sich blumenbestreut vor unseren Augen öffnete: Da kamen wir, am Ziele angelangt, dicht an eine Gondel, die wir bestiegen und die sich unter lautloser Stille zu heben begann. Wir waren in einem Luftschiff, das immer höher und höher stieg, über der Stadt noch einige Kreise beschrieb und dann sich zu entfernen begann, weit in den Himmel hinauf - - ins Unbegrenzte, Unendliche - - Undefinierbare! - - - ."[119]
Daß der Wunsch fliegen zu können, im Traum nichts anderes bedeutet als die Sehn sucht, geschlechtlicher Leistungen fähig zu sein, zeigte Freud auf. Es ist dies ein früh infantiler Wunsch.
Alban Bergs Lust am Verführen und Entführtwerden, teilte auch Thomas Mann, denn der Garten der Lüste kennt keine Grenzen. Die knabenbegehrende Glut befällt Gustav Aschenbach in Manns Erzählung „Der Tod in Venedig"[120] (1911). Die Liebe des Schriftstellers zu dem „bleichen und lieblichen" Tadzio wird in Choleralüften am Meer der Lagunenstadt ein tödliches Ende finden. Luchino Viscontis große filmische Komposition der Novelle „Morte a Venezia"[121] (,,Tod in Venedig", 1970) zitiert das Adagietto von Gustav Mahlers 5. Symphonie und mit dem Lied für Alt und Orchester aus der 3. Symphonie,[4]. Satz, ließ Visconti die Ephebophilie ausklingen. Das Meer wird zu Sterbelandschaft Gustav Aschenbachs werden, ,,er saß dort, sein Kopf brannte, sein Körper war mit klebrigem Schweiß bedeckt: Tadzio ging schräg hinunter zum Wasser. Er war barfuß und trug seinen gestreiften Leinenanzug mit roter Schleife (... ) Vom Festlande geschieden durch breite Wasser (... )wandelte er, eine höchst abgesonderte und verbindungslose Erscheinung, mit flatterndem Haar dort draußen im Meere, im Winde, vorm Nebelhaft-Grenzenlosen. Abermals blieb er zur Ausschau stehen. Und plötzlich, wie unter einer Erinnerung, einem Impuls, wandte er den Oberkörper, eine Hand in der Hüfte, in schöner Drehung aus seiner Grundpositur und blickte über die Schulter zum Ufer. Der Schauende dort saß wie er einst gesessen, als zuerst, von jener Schwelle zurückgesandt, dieser dämmergraue Blick dem seinen begegnet war. Sein Haupt war an der Lehne des Stuhles langsam der Bewegung des draußen Schreitenden gefolgt; nun hob es sich, gleichsam dem Blicke entgegen, und sank auf die Brust, so daß seine Augen von unten sahen, indes sein Antlitz dem schlaffen, innig versunkenem Ausdruck tiefen Schlummers zeigte. Ihm war aber, als ob der bleiche und liebliche Psychagog dort draußen ihm lächle, ihm winke; als ob er, die Hand aus der Hüfte lösend, hinausdeute, voranschwebe ins Verheißungsvoll-Ungeheure. Und wie so oft machte er sich auf, ihm zu folgen. Minuten vergingen, bis man dem seitlich im Stuhle Hinabgesunkenen zur Hilfe eilte. Man brachte ihn auf sein Zimmer. Und noch desselben Tages empfing eine respektvoll erschütterte Welt die Nachricht von seinem Tode."[122]
Seit der Jahrhundertwende und bis in die Dreißiger Jahre hinein entzogen sich Künstler der Unwirtlichkeit der Städte, sie alle einte eine pietistische Naturschwärmerei und Nietzsches Gedichttitel „Aus hohen Bergen"[123] ist auch für Anton Webern, [124] der begeisterte Alpinist liest Goethes „Metamorphose der Pflanze", rühmt „Wurzel, Stengel, Blatt, Blüte". Mit Sonnenaufgang erhebt er sich und ist in dünner Luft unterwegs, umgeben vom Eisblau der Gletscher. Am liebsten möchte er an den Rändern des Himmels arbeiten, dort, wo die unschein bare Edelraute wächst. Mit seinem Wanderstab streift er auf unwegsamen Pfaden den Blütenkelch des Kohlröschens, beugt sich sinnend über das seltene Edelweiß und schläft ein im betäubenden Duft der Alpenwiesen.
Anton Webern schreibt am 6. November 1904, im Anschluß an ein Konzert der Wiener Philharmoniker mit Werken von Mozart, Pfitzner und Beethoven fast programmatisch in sein Tagebuch. ,,Immer klarer offenbart sich mir der Genius Beethovens, gibt mir eine hohe Kraft, die Erfahrung, die letztliche Erfahrung, wo ein Schleier nach dem anderen zerreißt und immer strahlender sein Genie mir leuchtet - und eines Tags wird der Augenblick da sein, wo ich seine Göttlichkeit unmittelbar in hellster Reinheit empfange -- - Er ist der Trost meiner Seele, die nach Wahrheit sucht, schreit. Ich sehne mich nach einem Künstler in der Musik, wie's Segantini in der Malerei war, das müßte eine Musik sein, die der Mann einsam fern allen Weltgetriebes, im Anblick der Gletscher, des ewigen Eises und Schnees, der finsteren Bergriesen schreibt, so müßte sie sein wie Segantinis Bilder.[125] Das Brechen des Alpensturmes, die Wucht der Berge, das Leuch ten der Sommersonne auf den Blumenwiesen, das alles müßte in der Musik sein - eine unmittelbare Geburt der Alpeneinsamkeit. Der Mann wäre dann der Beethoven unserer Tage. Es müßte wieder eine Eroica kommen, eine die um 100 Jahre jünger ist." Anton Webern wird eine solche Musik schreiben, von der Adorno sagte: ,,Vor der Hütte seiner Musik äsen friedvoll miteinander der Wolf der Schuld und das Reh der Sanftmut. Denn der ländlichste Musiker dieser Tage ist der artistischste zugleich; seine Sprache ist der Dialekt der Berge oder das himmlische Latein."[126]
Die menschliche Stimme wird durch den Hauch (,,spiritus") des Menschen gebildet und Paul Klee ist es gelungen mit Farben den Hauch sichtbar zu machen: ,,Das Vokaltuch der Kammersängerin Rosa Silber" (1922) kann als eines der subtilsten Monogramm Bilder der Modeme gelten - die zierlichen Buchstaben scheinen wie mit Nadel und Zwirn in die gobelinartige Fläche gestickt. Die Handhabung feinster Pinsel, spitzer Bleistifte und Federn zeichnet die Werksgruppen der zwanziger Jahre aus. Paul Klee, ein Künstler, der für Denkweisen und Motive des Orients offen ist, legt Herbarien nach Sitte der Naturalienkabinette an und erkundet mit lianenhaften Linien die Strukturen von Blatt und Blütenformen; er komponiert die „Wasserpflanzenschrift" (1924) und erfindet Blumen, die im Linee-Katalog nicht zu finden sind. ,,Dynamoradiolaren" oder „Windmühlenblüten" nennt er die Bleistiftzeichnungen, die 1926 entstehen. ,,Seltsam fruchtbar" (1925) sind Klees "Mikrokosmographien" und die „Zeiten der Pflanzen" (1927) werden in Öl und Wasserfarben vorgeführt. Von „kleinen libellenhaften Bildern" hat Adolf Behne so schön gesprochen und fasziniert läßt man den Blick über das „Botanische Theater" schweifen, das Klee 1924 begonnen, aber erst zehn Jahre später vollendet hat. Der Stoß der Zeichnungen der letzten Lebensjahre zeigt den Absprung in die ungeschickte Hand des Kindes- der Maxime Plinius folgend, die da lautet: ,,nulla dies sine linea", läßt Klee ins terrain vague des Bleistiftgebietes geraten. Klees Kunst sucht ein „Nicht mehr", ein „noch nicht", ein ,,fast".
Einhundertzwanzig Pflanzen wird Karl Bloßfeldt, ein Pionier der Lichtbildnerei, in einem Tafelwerk mit dem Titel „Urformen der Kunst"[127] (1928) in Großaufnahmen erblühen lassen: Die Tiefdrucktafeln begeisterten schon Walter Benjamin, der unter diesen „Riesenpflanzen wie Liliputaner"[128] wandelte, und das „weibliche und vegetabilische Lebensprinzip"[129] darin erblickte. Der Fotograf Bloßfeldt, Inhaber einer Professur für plastisches Gestalten nach Pflanzen in Berlin, schrieb für den zweiten Pflanzenband „Wundergärten der Natur" ein Vorwort - der zweite Pflanzenatlas war wieder mit einhundertzwanzig Tafeln ausgestattet, und zuletzt hat man einundsechzig ,,Arbeitscollagen" entdeckt und publiziert.
Die Zeit, als das neunzehnte Jahrhundert ins zwanzigste kippte, ist die Zeit Bergs. In Wien am Alsergrund, Berggase 19, wagte sich Sigmund Freud in die Tiefen des Unbe wußten und deutet die Träume; hoch in den Bergen, nahe dem Schnee, nahe dem Adler, prophezeite Friedrich Nietzsche: ,,Man muß das All zersplittern, den Respekt vor dem All verlernen." Tausend Meter unter dem Meeresspiegel und auf dem Mond tauchte Jules Verne auf, Bühnenzauber und echte Magie erblühten im Gaslicht des neunzehn ten Jahrhunderts, und es ereigneten sich zu Hauf sexuelle Peitschenspielchen in den Stallungen der Superreichen und schmuddelige Orgien in den stickigen Quartieren des Lumpenproletariats.
Die gerichtete, beschleunigte Zeit hat sich nach und nach in der Moderne flächenförmig über den gesamten Gesellschaftskörper ausgebreitet. Aeroplan, Eisenbahn, Automobil, Telefon, Radio und Grammophon spielen extensive Rollen. Siegfried Kracauers „Schriften zur Massenkultur" bezeugten das „Tohuwabohu verdinglichter Seelen". Die futuristischen Apparate der modernen Zeit hat der Bauhauskünstler Otto Umbehr in der Montage „Der rasende Reporter" im Jahre 1926 ins Blickfeld gerückt, das Maschinen labor explodiert und man hat nie zuvor die Inkunabeln der Geschwindigkeit so fokussiert gesehen wie auf diesem Bild.
Dem Erlebnis der modernen Kommunikations- und Transportmittel[130] verschloß sich Alban Berg keineswegs - in seinem Leben spielen Film, Radio[131] und Telefon extensive Rollen. Auf seiner Visitenkarte funkelt die Telefonnummer „Telefon: Automat 84.8.31"[132] Über das Telefon ist er mit Hanna Fuchs, wie an einer Nabelschnur hängend, stets verbunden, Hannas Prager Telefonnummer ist in seinem Gedächtnis gespeichert:[87].3.2 Vl.[133] Sicherlich haben die Eisenbahn[134] und das Automobil - indem sie den Beobachter auf Reisen rasche Veränderungen der Gesichtspunkte ermöglichen und den Blick auf das wahrgenommene Sujet verändern - bei der Entwicklung der Musik Bergs eine Rolle gespielt. Im Autolärm der Großstädte gerät Alban Bergs Trommelfell in Schwingungen: ,,Jetzt bei der Autofahrt konnte ich ganz gut im Kopf arbeiten",[135] notiert er euphorisch.
Alban Berg und Franz Kafka teilen die Liebe zum Kino.[136] Diesem immer auf der Spur begeistert sich Berg für Pudowkins Film „MA" (,,Die Mutter", 1926) und Eisensteins „Bronenosec Potemkin"[137] (,,Panzerkreuzer Potemkin", 1926). Worum Theater und Oper des Westens sich vergeblich mühten, gelang Eisenstein in Filmen, die das Subjekt Werden der Massen erschließen. In den Filmen Eisensteins ereignen sich unge heuerliche Disproportionen wie sie auch in Romanen Tolstois aufblitzen, die Eisenstein bewunderte: etwa die „kriminellen"[138] Umarmungen von Anna Karenina und Wronski. Im Theater kam es bei Erwin Piscator und Max Reinhardt[139] zu einer architektonischen und geometrischen Behandlung der Menge, die später im expressionistischen Film und insbesondere in Fritz Langs „Metropolis" zum Dekoratismus der Masse führen wird, während Eisenstein die Individuation der Masse ins Mythische drängt.
Die Ästhetik Eisensteins hat die Revolution[140] im Auge. Die neurasthenische Stimmung kurz vor der ersten russischen Revolution von 1905 gibt Andrej Belyj in einem expressiven Roman in acht Kapiteln mit Prolog und Epilog wieder. In Belyjs „Petersburg"[141] (1913/14) ist die Irrealität des Moloch Großstadt - wie sie der Philosoph Georg Simmel beschrieben hat - Drehscheibe der Romanhandlung. Nebel und Nacht nisten im Asphaltdschungel von Sankt Petersburg, dessen tönendes Denkmal die Peter und-Paul Kathedrale ist: ,,Die Trottoirs flüsterten und schlürften unter der Rotte steinerner Riesen-Häuser"; ,,am anderen Ufer der Newa erhoben sich die riesigen Gebäude und warfen in den Nebel feurig entzündete Augen."[142] Bizarre Großstadt darstellungen und das Lebensgefühl der Menschheitsdämmerung[143] durchziehen wie ein schwarzer Strahl Malerei, Literatur, Film[144] und Theater der Modeme. Die Grund erfahrung der Moderne - in Hofmannsthals Brief an Lord Chandos durch die Metapher erfaßt, daß die Worte im Mund zerfallen wie modrige Pilze - haben entstehende Künst lerkollektive (Expressionisten, Dadaisten, Futuristen, Kubisten und Surrealisten) geteilt: Das Aas am Notenschlüssel verankerte die Schönberg-Schule.
Die experimentelle Kühnheit des russischen Stummfilms zwischen 1925 und 1930 scheint mit der leisen Formel der lkonenmalerei signiert, die da lautet, der Maler habe das Bild: ,,gemacht". Der Mensch, der aufgenommen wird, erklärt der Filmkünstler Pudowkin, ist nur Rohmaterial für die zukünftige Komposition seiner Gestalt im Film, bewirkt durch Montage. Wsewolod Pudowkin[145] und Sergej Eisenstein inszenierten die Gebärden des Schmerzes und der Revolte der Arbeiterklasse, Charles Baudelaire sprach von der emphatischen Wahrheit bei den großen Ereignissen des Lebens und in „Potemkin" ist es die Wahrheit der geballten Proletarierfaust, die Eisenstein auf der Leinwand installierte.
Wsewold Mejerhold rief die Massenschauspiele in Moskau unter freiem Himmel ins Leben und ließ Flugzeuge, Schiffe und Motorräder zirkulieren, begleitet von Geschütz donner und gellendem Sirenengeheul. Mit Maschinengewehren bewaffnete Männer und Frauen sangen vom „Reich des Friedens": Im Juli des Jahres 1920, zum Zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale führten 4000 Akteure das Stück „Zur Weltkommune" auf, das die Geschichte der Arbeiterbewegung von 1848 bis zur russi schen Revolution in pathetischen Bildern behandelte.
Die kinematographische Kunst Sergej Eisensteins nimmt den Bildausschnitt, das Einzelbild als Molekularfall der Montage: ,,Wenn Montage mit irgend etwas verglichen werden kann, dann wäre eine Serie von Montagestücken, von Aufnahmen, mit den Verbrennungsperioden eines Explosionsmotors vergleichbar, der das Automobil oder den Trakor antreibt: denn die Montage-Dynamik gibt die Impulse, die den ganzen Film vorantreiben."[146] In dem Essay „Hinter der Leinwand"[147] (1929) zeigte Sergej Eisenstein die filmeigenen Züge der japanischen Kultur auf und erinnerte daran, daß die darstel lende Kunst der Japaner auf dem Montageprinzip begründet sei und weiter lesen wir über die „filmeigene Methode im Zeichenunterricht": ,,Nach welcher Methode geht man bei uns im Zeichenunterricht vor? Du nimmst irgendein weißes Blatt Papier, das vier Ecken aufweist. Dann füllst du es - meist ohne die Ecken nur zu benutzen (... ) mit irgendeiner dösenden Karyatide, irgendeinem hochgestochenen Kapitell oder einem Gips-Dante (... ). Die Japaner gehen die Sache völlig anders an. Hier der Zweig eines Kirschbaums. Und der Schüler schneidet aus diesem Ganzen mit einem Quadrat, einem Kreis und einem Rechteck kompositionelle Einheiten heraus. Er schafft einen Bildaus schnitt."[148] Das Eisenstein-Kino gliedert mit der Kamera: ,,Das Heraushacken von einem Block Wirklichkeit mit der Axt des Objektivs"[149] ist die Maxime, denn das sowjetische Kino will das Auge spalten.
Im Sommer 1930 bestand Berg die Autolenkerprüfung. Mit Kinderaugen blättert der Autofetischist in Automobilprospekten,[150] ventiliert die Preise, gustiert Karosserieformen und -farben und umkreist die Objekte seiner Begierde mit braunen und blauen Farb stiften. Auf vielen Fotos begegnet er uns in der mondänen Sportkleidung [151] der 30er Jahre, sein heißgeliebtes englisches Kabriolett trägt die Autonummer A 30576.[152]
Zu Hauf gibt es Fotos aus dem Sommerfrischeleben[153] mit Helene Berg. Die Berge und die Seen verleiten zum Wandern und zum Schwimmen. Der Hausgarten lädt zum Verweilen unter Obstbäumen ein; der passionierte Raucher, [154] in weißen, kurzärmeligen Hemden tippt unbekümmert an der „Royal- Schreibmaschine",[155] kurvt im Alpenvorland mit der eleganten Ehefrau oder faulenzt im Dorfgasthaus - ein Hauch von Sommer frische-Glück durchzieht das umfangreiche Fotokonvolut.
Ein schöner Fotobeleg des jungen Alban Berg ist ein Paßbilderstreifen:[156] diese Be wegung des Mundes zum Lächeln, das sich der Kamera entgegenstreckt, ist über raschend. Bis zu seinem Tod hat Alban Berg ein leidenschaftliches Interesse für die Photographie bewahrt. Die letzte Aufnahme des Schwärmers gerät zum Dokument einer alternden Existenzschicht: Die Fragilität des Sensualisten, die brüchige Gesundheit tritt hervor - auf diesem Foto schaut man sich die Wunden[157] an, die irgendetwas hinter lassen hat.
Die Lyrische Suite hält eine Komplizenschaft mit der Kurzatmigkeit.[158] Marcel Proust und Alban Maria Johannes Berg waren
Astmathiker.[159] Man merkt es der
„Recherche"[160] an, daß sie aus den
stockenden Atemzügen des Autors ihr ästhetisches Kapital schlägt. So zittert auch die bedrängte Luftsäule
Bergs in der „Lyrischen Suite".
Bergs Atem schwillt an und ab, wölbt sich, mutierende Bewegungen wechseln
einander ab, die ganze Musik des Streichquartetts dehnt sich zwischen Beschleunigung und Ver langsamung des
Atems. Berg hält die wilde Lunge im Zaum wie den Phallus.
Der Atem formt den Rhythmus der „Lyrischen Suite". Das Tempo der lebhaften Sätze wird im 1., III. und V. Satz zunehmend schneller, das Tempo der getragenen Sätze[11], IV. und VI. Satz, immer langsamer.
In einem seiner „Brevier"-Gedichte, bittet der von schwerem Asthma gequälte Dichter Zbigniew Herbert: ,,Herr, II leih mir die gabe, lange sätze zu bilden, derenIlinie von atemzug zu atemzug sich spanntIwie hängebrücken, wie regenbogen, wie das alpha und omegaIdes ozeans II Herr, II leih mir kraft und geschick derer, die lange sätze bilden, I ausladend wie die eiche, geräumig wie ein weites tal, I damit in ihnen platz finden weiten, weltenschatten, I weiten aus dem traum."[161]
Auch Robert Louis Stevenson kennen wir nur als Kranken. Sein Lungenleiden, vermutlich eine chronische Bronchitis, die in den feuchtkalten Häusern Edinburghs kaum zu bekämpfen war, bestimmte unerbittlich den Rhythmus seiner Tage und Nächte. Schon als Kind verbrachte er ganze Monate im Bett, litt unter Fieberanfällen und spuckte Blut. Seine Kinderfrau Allison Cunningham, genannt „Cummy", blieb auf, wenn er nicht schlafen konnte, und vertrieb ihm die Zeit mit Vorlesen. Sein autobiographischer Gedichtband „A Child's Garden of Verses" (1885) ist ihr gewidmet.
Da ist eine Röntgenaufnahme Bergs aufgenommen am 7. Februar 1916. Das Bild zeigt ein bläuliches Gewirr knochiger Linien und verschwommener Organe. Es stellt das intimste Bild Alban Bergs zur Schau, weit mehr als ein Nacktfoto, nämlich das, was das Rätsel in sich birgt und das der Arzt Dr. Isaak Robinson leicht zu entschlüsseln vermag:
„Knöcherner Thorax von paralytischem Habitus. Verdichtung beider Spitzen, besonders links und beider Hillus von adenitischem Typus mit Einlagerung deutlich differenzierter, vergrößerter Drüsenknoten. Typisch tropfenförmiges, hypoplastisches Herz von labilem Durchmesser. Der ortho-diagr. Durchmesser schwankt nicht nur bei In- und Expiration, sondern an verschiedenen Tagen zwischen 10 und 11,[5] cm. Der Körpergröße des Patienten würde ein Herz von 13 cm entsprechen."[162]
Erkrankungen der Lunge machen Fieber und müde. Im Pariser Atelier liegt der schwerkranke Amedeo Modigliani[163] mit seiner Geliebten Jeanne Hebuterne auf einem schmutzigen Schragen. Wir sehen ihn auf einem der letzten Fotos[164] (1916) in einem verbeulten Cord-Anzug vor uns in seinem Atelier sitzen, fünfunddreißig ist er nun. Er hat ein Bein über das andere geschlagen, die linke, lockere Faust erschöpft auf sein Knie gelegt und hält in der Rechten eine glimmende Zigarette. Die Tuberkulose,[165] der Amedeo Modigliani seit neunzehn Jahren sein Werk abgetrotzt hat, hat die Gesichtszüge noch männlicher werden lassen. Mit „schauderhaften Asthma-Anfällen, oft 20 Stunden lang"[166] ringt Alban Berg. Erschlaffungen des Körpers sind die Folge, die Musik schreibt er langsamer, die Lunge bändigt den Schaffungsdrang.
Alles beginnt mit der Haut, mit dem Fleisch. Hinter Modiglianis Kunst beginnt die schwindelerregende Zärtlichkeit, so auch in der Kunst Bergs. Modiglianis Köpfe haben den langen „Schwanenhals voller Liebesgeflüster",[167] die überlangen Notenhälse Bergs ragen in die Höhe, um auf dem kürzesten Weg den Liebessehnsüchten zu folgen.
Da ist Modiglianis Vision einesTempeIs der Liebe ; alle Bildhauereien waren als Säulen zu diesem Tempel gedacht, die Karyatidenskizzen[168] sind Entwürfe dazu, eine große Rolle spielten in diesem Plan alle Zeichnungen, die er rot aquarellierte. Er nannte die Säulen, die er nach ihnen ausführen wollte, ,,colonnes de tendresse", SäuIenderZärtIichkeit , ,,sie hätten zu Hunderten diesen Tempel umgeben."[169] Die Lyrische Suite läßt Berg mit 931 Takten zu einem „kleinen Denkmal einer großen Liebe"[170] emporwachsen. Alle diese Töne, die zwei Geigen, eine Bratsche und ein Violoncello erzeugen, vernimmt man als eine erektile Bewegung, als leiden schaftliches Crescendo, das schließlich Abschied von aller Tiefe des Begehrens zu nehmen beginnt.
Das zartgliedrige Musikkunstwerk ist unweit der Morgenröte, in Atemangst und in einer vibrierenden Überspanntheit zum Abschluß gekommen: ,,30. Sept. 1926,[1] Uhr nachts (Morgen einer Asthmanacht)"[171] lautet die lakonische Eintragung am Ende des VI. Satzes der Partitur, doch dahinter verbirgt sich ein bewegender Schmerzensausbruch. Der Preis dieses Projektes existentieller Selbstverkunstung ist der körperliche Zusammenbruch Bergs: ,,(... ) Die letzten drei Wochen in Trahütten (halben Sept. bis 5. Oktober) [1926] waren die aufwühlendsten Tage dieses Jahres. Nichts mehr hörte ich von Dir - ach, ich wußte ja auch nicht mehr, ob Du mich noch liebst - - und ich weiß es heute ja auch nicht ...... Ich stürzte mich in die Arbeit. Das Quartett mußte fertig werden. Der letzte Satz, das de profundis clamavi: ,zu Dir, Du einzig Teure dringt mein Schrei ... ' mußte endlich niedergeschrieben werden. In fieberhafter Eile (ich wollte ja möglichst schnell nach Wien zurück, da Du Deine Ankunft in Wien für Oktober an kündigtest, wollte ich am 1. Oktober in Wien sein und eigentlich die ganze Zeit krank, komponierte ich an diesem Lied ohne Worte (denn niemand außer Dir darf wissen, daß diese Töne des letzten Satzes den Worten Baudelaires unterlegt sind!) Und beendete in der Nacht vom letzten September den Satz und damit das ganze Quartett. Die Aufregung dieses Erlebnisses (wovon die Komposition nur ein schwacher Abklatsch ist) war aber zuviel: Tags darauf brach ich völlig nieder."[172]
Er wird von dem traumatisierenden Liebeserlebnis mit Hanna nicht mehr loskommen. Von nun an will der Zug der Schatten kein Ende mehr nehmen, Tränen und Trost warten in der Selbstzerfleischung. In einen trostlosen Strom zwanghaften Dahinschreibens wird auch der knapp fünfundsechzigjährige Arthur Schnitzler in seiner Döblinger Villa geraten. Der Dichter des „Reigen" und der „Traumnovelle" ist einsam bis zur Verzweif lung, ,,jede Nacht ein tiefrer Abgrund"[173], verrät das Tagebuch aus dem Jahre 1930. Neunzehntausend Tage auf knapp achttausend Manuskriptseiten vermisst Schnitzler im Zeitraum 1879-1931. Ein schwermütiger Schatten liegt auf leisen Aufzeichnungen, das Tagebuch könnte „mich von aller quälenden Einsamkeit befreien, wenn ich jenseits meines Grabes Freunde wüßte".[174]
Kafkas Lunge zerbricht wie ein Stück Porzellan. Bergs Bronchien scheinen sich jeden Augenblick aufzublähen. Die „Keucherei" übersteht er dank „Codein-Pulver, Morphium, Brom und Nasenpinselungen".[175] Der Dauergast von Bergs Körper, das Asthma und sein hypnotischer Zusammenschluss mit der Musik findet in der Korrespondenz [176] mit Anton Webern immer wieder Erwähnung. Es ist wohl dieses Geräusch, das auf dem Grunde der Musik das zum Klingen bringt, was man nicht zu hören vermag.
Wien,18.11.1911: ,,Trotz größter Schonung u. aller Mittel ist die Athemnot noch nicht dauernd geschwunden."
Wien,19.11.1911: ,,Ich muss eben immer mit meiner elenden Gesundheit rechnen. Ich bin auch jetzt nicht wohl. Ich leide an Gerstenkörnern, gleich 4 an einem Auge. Das Wort ,leiden' ist nicht zu übertrieben, nachdem dieses lächerlich blödsinnige Uebel eine äusserst schmerzhafte Entzündung des Auges u. der ganzen linken Gesichtshälfte nach sich zieht."
Trahütten, 12.10.1925: ,,(... ) drum kann ich Dir vorderhand auch noch nicht viel berichten über meine derzeitige Arbeit am Streichquartett.+ Es geht mir nicht recht von der Hand. Aber ich bin vielleicht auch sehr müd, gesundheitlich nicht auf der Höhe (... ) Es soll übrigens eine Suite f. Streichquartett werden. 6 kürzere Sätze mehr lyrischen als symphonischen Charakters."
Wien,31.10.1925: ,,Mein Lieber, ich bin wieder hier. Leider asthmatisch. Sobald ich Luft habe, hörst Du von mir."
Wien,9.11.1925: ,,Nun haben wir uns, mein lieber Toni, noch immer nicht ausgeplauscht und dabei hätte ich Dir so viel zu sagen (... ) dann kam meine Mutter, die ich 9 Monate nicht sah, u. schliesslich jetzt, wo ich endlich wieder Luft hätte (in jedem Sinn) erhalte ich eben ein Telegramm von Kleiber,[177] ich möge nach Berlin kommen."
Trahütten, 7.6.1926: ,,Tausend Dank, mein Liebster, f. D. Karte (... ) Nach zwei Wochen Hiersein ist es mir endlich geglückt den eingerosteten Arbeitskarren wieder in Bewe gung zu setzen. Ich schreibe am Quartett. Leider daneben auch wieder Korrekturlesen! die ,Wozzeck-Partitur' u. in Kürze den ,Konzert-Klavier-Auszug'. Sehr zeitraubend, wenn ich es auch nur nachprüfe u. kontrolliere."
Trahütten, 28.6.1926: ,,Ich arbeite unentwegt, leider etwas mit nervöser Hast (... ) Ich möchte diese kurze Zeit hier wenigstens soviel skizzieren, um in Wien daran arbeiten zu können."
Trahütten, 26.7.1926: ,,Die Beschwerden meiner Frau sind die gleichen wie immer. Kein Wunder bei diesem Sommer. Ich selbst leide an den nun über 1 Jahr alten Magen (oder Gedärm) schmerzen. Ich muss zu einem Arzt."
Wien,4.9.1926: ,,(... ) ich bin bei meiner Arbeit am Quartett, das ich noch vor Saison beginn fertig kriegen möchte (... ) Dann bin ich auch nicht ganz gesund. Ischias? Sehr schmerzhaft! Ua wir werden alt!)"
Trahütten, 27.9.1926: ,,Mein Lieber, nun bin ich schon da, ohne dass wir uns getroffen haben. Ich war zu all der Arbeit die letzte Zeit noch krank, ein schwerer Katharrh u. entschloss mich - als sich die Gelegenheit dazu ergab - schnell herauf zu fahren, in der Hoffnung schneller gesund und Arbeitsfähig zu werden. Etwas was leider eine Täuschung war die irritierten Asthmaorgane erzeugten fürs erste besonders starkes Asthma u. an Arbeit ist dabei nicht zu denken. Ich lege alles darauf an, bald gesund zu werden, was ja bei diesem herrlichsten Herbst u. dazu da heroben möglich sein muss (... ) Verzeih diesen Brief! Aber ich schreib in schwerer Athemnot!"
Wien,8.10.1926: ,,Mein Liebster, ich bin seit 3 Tagen zurück. Ich war sehr krank u. scheinbar lange nicht wirklich wohl, was augenblicklich sehr peinlich ist, da ich ja wegen des Konzerts am 13. (die unvermeidlichen ,Bruchstücke') bei vielen Proben sein muss (... ) Mein Quartett ist fertig; jetzt geht's an die Reinschrift, bei der noch die letzte Feile angelegt wird u. die Spuren der Werkstatt getilgt werden. Dann kommt endlich für mich der Freudenaugenblick Dir das Ganze zu zeigen. Dank Dir tausendmal für Deinen lieben prachtvollen Brief, der mir ein Labsal in schwerer Krankenzeit war."
Wien,31.12.1926: ,,Ich stecke mitten in den Proben meines Quartetts u. bin in großer Not. Es ist doch wiederrum sehr schwer, jedenfalls viel zu schwer, als dass in der kurzen Zeit (bei so viel Probenentfall an Feiertagen) eine gute Aufführung zustande kommen kann (dies bitte diskret zu behandeln). - Wir sind noch nicht einmal durch das Ganze mit dem ersten (Noten-)studium durch, zwei Sätz werden soviel wie überhaupt noch nicht gespielt. Am Sonntag oder Montag hoffe ich ein Stadium erreicht zu haben, in welchem ein über die gröbsten Züge hinausgehendes feineres Studium einsetzen kann u. da möchte ich Dich vielmals bitten Dir die Sache einmal anzuhören."
Trahütten, 8.7.1927: ,,Ich habe Dir, mein Lieber, lange nicht geschrieben; ich war sehr krank u. bin erst am Weg der Besserung. Ausser Asthma, das diesmal besonders schwer war, bin ich auch sonst ganz herunten und - was das ,Aergste ist: arbeits unfähig."'
Trahütten, 13.7.1927: ,,Wenn es mir jetzt auch etwas besser geht (von kleinen Rück fällen abgesehen), so fühle ich mich dennoch so elend (- als wäre ich plötzlich um 20 Jahre älter -) dass ich zur Arbeit weder Lust noch Fähigkeit habe. (Nur die Qual, arbeiten zu müssen u. nicht zu können!) Nur liegen und - Warten."
Trahütten, 21.7.1927: ,,Neben dem Asthma u. der Qual mit den Schleimhäuten der Asthmaorgane (Heuschnupfen (?), Augenthränen, Niesskrämpfe etz) derzufolge man wochenlang wie besoffen herumgeht, versagten auch die Verdauungsorgane, an denen ich seit über 2 Jahren leide, völlig. Ich durfte tagelang überhaupt nichts essen, um damit wieder halbwegs auf gleich zu kommen. Allerdings, dass es so weit kommen konnte, u. so mit einem Schlag über mich herfallen konnte, sind mehr die Nerven schuld, die eben plötzlich versagten u. keinen Widerstand boten. Und daran ist wohl schuld - da hast Du sehr recht - dass ich mir ,in der letzten Zeit allzuviel zugemutet habe'. Die letzte Saison war wirklich zu strapaziös für mich. Ich habe sie schon als Kranker begonnen. Die 14 Tage im Sept. in Trahütten war ich ja schon so miserabel, dass ich nur mit Aufbietung der letzten Kräfte die ,lyr. Suite' fertig schreiben konnte. Dann kam die Saison mit ihren laufenden Saisonarbeiten. Dazu die vielen Premieren, die Reisen mit ihren unvermeid lichen Aufregungen (2mal Berlin, Prag(!), Zürich, Leningrad)[178] Und zu all dem die rein persönlichen Erlebnisse dieses letzten Halbjahres - - vom Tod meiner Mutter[179] bis zur Operation[180] meiner Frau. Solange es Not tut, ist man diesen Dingen unbegreiflicher weise gewachsen; dann aber klappt man plötzlich zusammen. Und das hab' ich halt jetzt wieder einmal erlebt, wie vor 7Jahren nach Kriegsschluß."
Wenn man seinen Kopf auf die Brust eines lungenkranken legt, hört man Wasserfälle rauschen. ,,Gib mir eine Augenblick die Hand auf die Stirn, damit ich Mut bekomme", wird Franz Kafka am Sterbebett zu Dora sagen. Während seines Aufenthaltes in Muritz an der Ostsee trifft Franz Kafka im Jahre 1923 auf die aus Brzezen stammende junge Polin, Dora Diamant (Dymant). Der Dichter liebt „ein dunkles, ahnungsvolles Etwas, wie aus seinem Dostojewskijbuch[181] entlaufen" und zieht mit Dora nach Berlin-Steglitz. Manchmal träumen sie davon, verheiratet zu sein. Sie würden ein Lokal eröffnen. In Berlin oder in Palästina. Dora würde kochen, Franz wäre der Kellner. Nach einem halben Jahr nimmt der Berliner Aufenthalt ein bitteres Ende, von Tag zu Tag wird Kafkas Zustand schlechter, er ist von ständiger Atemnot, Husten und Stimmstörungen geplagt, für alles unfähig, außer für Schmerzen.
Am 5. April 1924 begibt sich Kafka in Begleitung der Geliebten in das Sanatorium Wienerwald,75 km südlich von Wien gelegen. Er kann nur noch flüstern und wiegt 49 Kilogramm. Gegen das Fieber bekommt er drei mal täglich flüssiges Pyramidon, gegen den Husten Demopon, das nicht hilft. Innerhalb weniger Tage schwillt der Kehlkopf so sehr an, dass Kafka große Schwierigkeiten beim Essen hat und weiter abmagert. Eine Übersiedlung in das Wiener Allgemeine Krankenhaus ist vonnöten und bei der Unter suchung in der Larynkologischen Klinik werden Verdickungsherde an der Hinterwand des Kehlkopfes und von Ödemen befallene Aryknorpel diagnostiziert. Man hat Kafka ein Mehrbettzimmer in der StationBim ersten Stock des westöstlichen Traktes zugewiesen. Die Düsternis des Krankenhauses und der Tod des kehlkopftuberkulosekranken Zimmernachbars Josef Schramme! bedrücken Kafka so sehr, daß er am 19. April 1924 ins Privatsanatorium Dr. Hoffmann in Kierling bei Klosterneuburg wechselt. Hier sitzt Dora Diamant zusammen mit dem jungen Medizinstudenten Robert Klopstock Tag und Nacht an Kafkas Krankenbett. ,,Ich bin sehr schwach", schreibt er nach einer Woche. Kafka befindet sich im letzten, unheilbaren Stadium der Tuberkulose, allgemein als Schwindsucht bekannt. Die Nahrungsaufnahme fällt ihm immer schwerer, er kann nur breiige oder leicht gleitende Speisen wie Joghurt, Teigwaren, Getränke, bei nach vorn geneigtem Kopf zu sich nehmen. Der Todgeweihte soll den Freund beschworen haben, die Geliebte zu gegebener Zeit unter irgendeinem Vorwand wegzuschicken, damit ihr der Anblick seines Endes erspart bliebe. Dann kam der 3. Juni und sie wurde mit dem
Auftrag fortgeschickt, einen Brief einzuwerfen - so berichtet eine Krankenschwester. Kafka soll es sich darauf aber anders überlegt haben, ein Zimmermädchen musste sie zurückbringen. Atemlos sei Dora Diamant zurückgekommen, einen Blumenstrauß in der Hand. Kafka soll sich ein letztes Mal aufgerichtet haben, um die Blumen zu riechen. Sein besonderes Interesse gilt den Blumen, die ihm umgeben. Er wünscht sich Goldregen und möchte sich besonders der Pfingstrosen annehmen, ,,weil sie so gebrechlich sind". Als „Das Schloss"[182] zwei Jahre nach Kafkas Tod veröffentlich wurde, signiert eine junge Frau Exemplare des Buches mit Dora Diamant-Kafka. Ihr einziges Kind, aus der Ehe mit Lutz Larsk, 1934 in Berlin geboren, nannte sie Franziska Marianne. Wohin sie auch ging, sie trug ein Foto von Kafka mit sich.[183]
Kafkas Schreibakte, die sich in direktem Verhältnis zur unendlichen Potenz seines Begehrens beschleunigten, mündeten in ausufernde Liebeskorrespondenzen. Die „Lust an Briefen"[184] gerichtet an Felice Bauer,[185] Milena Jesenska und Grete Bloch[186] geriet zur blutsaugenden [187] Obsession. Der Briefsüchtige „trinkt die Briefe und weiß nichts als daß man nicht aufhören will zu trinken".[188] Felice Bauer himmelt er als „auf das Blut gequältes, liebstes Mädchen"[189] an und attackiert sie „wie ein Indianer seinen Feind";[190] Milena verrät er schließlich, daß „diese Briefe, so wie sie sind", zu nichts helfen, ,,als zu quälen und quälen sie nicht, ist es noch schlimmer" .[191] Nie sieht er einen Grund innezuhalten: ,,Liebes Fräulein, nun raube ich Ihnen Ihre Nächte, sehe Ihr alle meine Vorstellungen und Fähigkeiten übersteigendes Mitgefühl, wärme mich daran ganze Tage und antworte nicht."[192]
Atemlos, stumm und bloßgelegt bis auf die Knochen stirbt der pensionierte Versiche rungsangestellte Dr. Franz Kafka, einundvierzig Jahre alt, am 3. Juni 1924 an Kehlkopf Tuberkulose im Sanatorium Dr. Hoffmann in Kierling.[193] In der Luft liegt ein kindlicher Zauber, den Dora Diamant erzeugt. Der Sterbende streift mit der Feder noch einige Papierbögen, die in die Literaturgeschichte als „Gesprächsblätter"[194] eingegangen sind.
Schlagen wir in dem Hanna Fuchs gewidmeten Noten-Band einzelne Seiten nach, um das feinnervige Tongebilde der „Lyrischen Suite" besser vor Augen zu führen. Rote Tintenmarkierungen, Klammern und Randtexte durchziehen die deutsch/englisch/ französische Vorrede von Erwin Stein.[195] Die Passagen des V. und VI. Satzes sind von Alban Berg am Rande angestrichen, ,,die Komposition mit zwölf Tönen wird als „lyrisch dramatische" hervorgehoben: ,,Die Entwicklung im großen ist keine symphonisch epische, sondern eine lyrisch-dramatische: eine Steigerung der Stimmungs- und Ausdrucksintensität. Schon die Tempobezeichnungen der sechs Sätze weisen darauf hin. Dem heiteren Gleichmut des Allegretto gioviale folgt ein liebliches Andante amoroso; hierauf ein im Charakter prononciertes, im Ausdruck zunächst verhaltenes Allegro misterioso mit heftigen Ausbrüchen im Mittelsatz, dem Trio estatico, in dem voll strömendem Gesang des Adagio appassionato ist die Klimax der lyrischen Steigerung erreicht, das Presto delirando mit dem Mittelsatz Tenebroso bildet die Peripetie; das Largo desolato schließlich verklingt in trostloser Verzweiflung (... )"[196] In der Einleitung betont Erwin Stein, dass im Finale des Streichquartettes „die scheinbar so gebundene, Komposition mit zwölf Tönen' hier dem Komponisten die Freiheit gelassen hat, die Anfangstakte des ,Tristan' zu zitieren."
Alban Berg, der Meister des Quartetts,[197] verknüpft in der „Lyrischen Suite" Reihen Technik und Tonalität. Mit der Reihen-Technik ist die Zahl als Ordnungszahl eines Reihentons Bestandteil der Komposition. Jeder Satz und Satzteil sei „in Beziehung zu" Alban Bergs und Hanna Fuchs „Zahlen 10 und 23 zu bringen."[198] Berg sah die Zahl 23 als seine persönliche Schicksalszahl[199] an. Willi Reich berichtet, daß Berg am 23. Juli 1908 im Alter von 23 Jahren den ersten Anfang von Bronchialasthma[200] erlitt. Berg starb[201] am 23. Dezember 1935 an einem Darmabszeß. So steht die Zugreise - in Begleitung von „Doktor Wiesengrund" - von Prag nach Wien im Mai 1925 „im Zeichen" der „Zahl 23. Der Waggon hatte die Nummer 946, die Fahrkarte [gleichfalls]".[202]
In der Quartettsuite[203] spielt neben der Zahl 23 auch Hannas Schicksalszahl 10 eine dominierende Rolle. Der Name Hannas zählt 10 Buchstaben, sie wurde am 10. Juli 1894 geboren. Die Zahl 10 findet man in der Metronomangabe ¼ = 100. Fünf Buch staben des Vornamens werden ebenso variiert: ,,Die Zahlen sprechen. Kannst Du glauben, daß es ein Zufall ist, daß uns das Schicksal, das uns auseinanderriß, in glei cher Stunde noch (hier kann man es wirklich einmal aussprechen: ,ausgerechnet'!) in unseren Zahlen 10 und 23 verband, der Nummer, der Fahrkarte 1023, die nur unsere leibliche Entfernung voneinander vergrößern konnte! Wäre es nicht Verbrechen (ich sagte schon einmal: ,Verbrechen wider den heiligen Geist') solchen Schicksalszahlen nicht zu gehorchen?!"[204]
Wie subtil Musik über Zeit und Vergänglichkeit in gänzlicher Abstraktion zu meditieren im Stande ist, zeigt Alban Berg Hanna Fuchs in der Widmungspartitur auf. Berg gibt Einsicht in das Taktgefüge der Komposition, das in mathematisch klügster Überlegung erfolgt ist. Notenbücher werden schwarz gedruckt. Katsushika Hokusai, ein Meister der drucktechnischen Verfahren sagt: ,,Es gibt ein Schwarz, das alt ist, und ein Schwarz, das frisch ist."[205] In den glänzend schwarzen, scharfgestochenen Taktzahlen der Wid mungspartitur bilden alle jene roten Tintenringe, die sie umschließen einen flimmernden Kontrast: Die magisch-absolute Zahlenwelt Bergs rollt auf 931 Takten wie ein Räder werk ab, und die Stetigkeit der Zahlen 10 und 23 fließt in Farben eines sanften roten Feuers.
69 Takte lang ist der 1. Satz: ,,[3] x 23 Takte", der 80. Takt im II. Satz ist mit „8 x 10" und das Satzende mit „15 x 1O" Takten rot markiert. Im III. Satz pulsiert das Vielfache der Zahl 23 im 69. Takt: ,,[3] x 23 Takte", im 92. Takt: ,,[4] x 23 Takte" und im 138 Takt: ,,[6] x 23 Takte". Der IV. Satz ist wie der 1. Satz 69 Takte lang: ,,[3] x 23 Takte". Voller Überraschungen ist der V. Satz, es zirkuliert die Zahl 10. Takt 120: ,,[12] x 10", Takt 210: „21 x 10", Takt 320: ,,32 x 10", Schlußtakt 460: ,,[2] x 23 x 10". Die Rotation der Takte des VI. Satzes endet wie in den Sätzen I und IV in Takt 69: ,,[3] x 23 Takte". Welch numerologische Geheimniskrämerei entzückt das Auge und beglückt das Ohr. Was für eine Zahlenkombination: nur übertroffen von der „Melancholie"[206] Radierung Dürers: 1514 ist der Stich datiert.
Die Tonkonstruktion des ersten Satzes der „Lyrischen Suite" registriert die infinitesi malen Augenblicke des Empfangs im Hause Fuchs-Robettin. Die 69 Takte wirken wie lange Schwenks auf die ersten Stunden, die Berg mit Hanna verbrachte.
Elfenbeinfarben ist die Musik des 1. Satzes, Allegretto gioviale, der die Tonarten F-Dur und H-Dur streift, wobei F-Dur nach Taktzahlen überwiegt: ,,Dieser erste Satz, dessen fast belanglose Stimmung die folgende Tragödie nicht ahnen läßt, streift immerwährend die Tonarten H- und F-Dur. Auch das Hauptthema (die dem ganzen Quartett zugrunde liegende 12-Tonreihe) wird von Deinen Buchstaben F... H umschlossen".[207] Unter den ersten Akkord pinselt Berg mit Tintenblau den BuchstabenFund über dem letzten Akkord in Takt 69 leuchtet der blaue BuchstabeHwieder auf. Der „blaue Himmel"[208] von Hannas Augen blitzt auf. ,,Blau ist die universelle Liebe, in welcher der Mensch badet - es ist das irdische Paradies ... Das Blut der Empfindsamkeit ist blau", sagt so schön der Farbenmystiker Derek Jarman,[209] der seinen letzten Film „Blue" (1993) nannte.
In die Grundfläche des Notenwerkes des 1. Satzes sind F-Dur und H-Dur wie vorbei sausende Asteroiden mit roter Tusche gekennzeichnet. So aufgeregt perlend die Noten, so mathematisch berechnet die kompositorische Form, die sie ordnet. Die Takte 2-4,[42]-44 werden als „Hauptthema" gekennzeichnet. Berg schreibt das Hauptsatzthema mit Allegretto gioviale, Viertel = 100 (Tempo 1) und das Seitensatzthema mit Poco piu tranquillo (Tempo II) an, dazwischen blitzen öfter ein accelerando und ein allergando auf. Berg gibt den ersten Hinweis auf F-Dur im Hauptsatz der Exposition unter Takt 2 in Klammern, dann unter der Bratschenstimme des 5. Taktes sowie unter Takt 13, in der Reprise unter Takt 49 und über der ersten Violine des Seitenthemas Takt 53. Die Tonart H-Dur ist in der Exposition in Takt 23 und Takt 36 eingetragen, in Takt 65 mit einer gestrichelten Linie gekennzeichnet, die bis in die Mitte von Takt 66 führt, wo sie F-Dur begegnet und unter dem abschließenden Hanna-Akkord in Takt 69 endet. Jedes eingetragene, farbige Detail mag eine Antwort sein auf die Fragen, die Hanna stellen könnte.
Berg führt Hanna in der Art eines Don Juan von Takt zu Takt. Das Bimbam von H-Dur und F-Dur ist die großartige Utopie einer Reihen-Extase, die Doppeltonalität F-H und deren Explosion auf dem Papier bedeuten anhaltende Zeit, Verewigung des Augen blicks, sie geben dem Abwesenden und dem Imaginativen eine vermittelnde Weise der Anwesenheit, dem Abstrakten Vorstellbarkeit.
Extrovertiert, gesellig, glücklich musiziert Berg im zweiten Satz. Der 11. Satz des Streichquartettes wird Andante amorosa genannt. Zartrot ist amorosa im Widmungs exemplar unterstrichen. Die Seite 11 der Taschenpartitur sprenkelt Berg mit graziler roter Handschrift:[210] „Dir und Deinen Kindern ist dieses ,Rondo' gewidmet. Eine musikalische Form, in der die Themen, (namentlich Deines) - den lieblichen Kreis schließend - immer wiederkehren."[211] Berg, der Mann zwischen den zwei Frauen, den zwei Müttern. Das Davonfliegen des Mutterbodens hinterläßt Muttermale. Der ersten widmet Berg ver trauliche Briefe und seine erste Komposition: ,,Mein erster Walzer Op. 1. Meiner lieben Mama[212] gewidmet" und die zweite, Hanna Fuchs, entgrenzt sichtlich seinen Musik- und Redefluß.
Hanna Fuchs, die den Kosenamen „Moppinka" trägt, ist Mutter von Dorothea, gerufen Dodo und von Frantisek, gerufen Munzo. Sie ist verheiratet mit Herbert Fuchs-Robettin, dem Eigentümer von Papiermühlen in Prag und Oberösterreich. Die wohlhabende jüdische Familie wohnte im Haus Nr. 593 in Bubenec-Prag und residierte auch in Kamnitz.[213]
Berg gleitet mit Hilfe von Tönen so wundervoll erregt durch Zeiten und Räume, die er mit Hanna teilte und so gerät das Streichquartett zu einer Echolalie von Myriaden sinn licher Augenblicke, der sich die Liebenden aussetzten. Hanna, die Madonna, als wäre sie aus Raffaels[214] Hand, es riecht nach weißen Lilien. Sein Auge fällt auf sie, ihre hochgelben Haarlockenlinien,[215] die flamingofarbene Halslinie, die „rosigen Fersen".[216] Er geht fortwährend dem Echo nach, dem Echo dieses Blühens: ,,Was sind das für Momente unendlichen Glücks, das ich mit Dir (... ) verlebe. Diese Deine Anwesenheit gestern Nachmittag in der Bibliothek, dieses Wunder einer rosa Blüte, das sich da vor meinen zum Bersten vollen Sinnen auftat - - - - diese, unsere Blicke in denen Liebeslust und - Leid eingefangen ist, wie sie noch nie auf Erden erlebt wurden".[217]
Mit lyrischer Emphase inszeniert Alban Berg den Diskurs des Liebenden. Einzig daran hangelt sich die Musik entlang, von Satz zu Satz in grelleren Farben gezeichnet. Der graphische Wirbel, den Berg mit den ästhetischen Polen von Farben, Linien, Klammern und Satzstücken im II. Satz der Taschenpartitur entfaltet, gerät zu einer Augenweide der wunderbarsten Art. Wie Muscheln an versunkene Schiffe, lagern sich die bunten Farbtuschen an das schwarze Notengerüst.
Hanna, Dodo und Munzo werden in der Widmungspartitur im 11. Satz in eine farbige Stofflichkeit getaucht. Ein Geäder von roten, blauen und grünen Linien, die jeweils mit Pfeilspitze und gefiedertem Anfang versehen sind, durchzieht die Notation- wie ein Pfeil, der von der Bogensehne fortschnellt, können die Linien nicht aufgehalten werden: sie gleichen Pfeilen Amors. Von einem Punkt zum anderen eröffnet sich auf 150 Takten ein Dreieck, dessen Grundfläche Hanna, Munzo und Dodo abgeben. Berg macht aus Hanna eine gefühlvolle, überschwengliche, leidenschaftliche Mutter-Seele und empfin det tiefste Beglückung über deren Kinder: ,,Dodo natürlich obenan. (... ) Halt ich doch, wenn ich Dodo umarme fast Dich in meinen Armen, spüre ich Dein geliebtes, wider spenstiges Haar, wenn ich ihren Lockenkopf streichle."[218]
Bei Bergs erstem Besuch im Hause Fuchs-Robettin im Mai 1925 waren eine Spielzeugtrompete und ein Windrad die Geschenke[219] an Hannas Kinder Dorothea und Frantisek. Nicht irgendein Mensch war gekommen, nein - ein berühmter Komponist. Er spricht schön von Musik in einem vornehmen Hause und während langanhaltender, verschie denartiger Unterhaltungen in denkbar bester Gesellschaft trinkt er limonengrünen Wein. Jeder Winkel, jede Stelle, jedes bisschen Raum ist Licht. Farben von Fayancen, Teppi chen, Tapeten und Vorhängen explodieren auf der Netzhaut. Hannas Schwanenteint bannt ihn und wenn sie ihn in stillen Zimmern ansah, so zerfloß er. Von allen Seiten strömt Lebensfreude auf ihn ein; von Zeit zu Zeit lacht er und er ist gelöst inmitten der lustigen Kinderausgelassenheit, sein feines Ohr vernimmt den leisen slawischen Ein schlag in Munzos Stimmchen - ein Tonfall den er nicht vergessen wird, ebensowenig das seltene Ereignis als den „Kindern die Haare geschnitten wurden".[220] Berg genoss das Bellen der Hunde und den Anblick der Bilder bis zu „dem letzten Abschiedsblick im Schatten"[221] des Haustores, wo Hanna im „schwarzen Kleide"[222] stand. Nach Wien zurückgekehrt bedauert er, daß manche Fotos von den „lieben, lieben Kindern"[223] nicht so gelungen seien: ,,Was für eine große Freude haben Sie mir, verehrte gnädige Frau, mit den Fotographien gemacht! Sind diese sieben Bilder doch mehr als das, sind sie doch nun auch sichtbare Zeichen einer Erinnerung an diese so schönen sieben Mai Tage in Bubenec. Ich finde sie auch fotographisch sehr gelungen; besonders das Bibliothek-Bild. Nur die lieben, lieben Kinder sind auf der Ansicht des Hauses zu klein.
Bekomm' ich nicht doch einmal größere?"[224] Er bekam sie und verliert sie nicht mehr aus den Augen.
Das „Verzücktsein"[225] über Hanna und die ihren und seine bis „an süßeste Schauer grenzende Kinderliebe"[226] zirkuliert im zweiten Satz des Streichquartettes. Den II. Satz überführt Berg in eine erregende Rondo-Atmosphäre und er zeigt in der Widmungs partitur die suggestive Spannkraft der Klangbilder, die in großen Bögen atmen. Die Kinderfarben Blau (,,Munzo"-Thema ) und Grün (,,Dodo"-Thema) schießen immer wieder wie ein opalisierender Strahl im Rot (Hanna-Thema) auf; mit den drei Primärfarben Rot, Blau und Grün, die sich ringsum auf weißem Grund und durch das Schwarz der Notation schlängeln, entsteht ein Tanz der Farben, die nach vorn kommen oder zurück weichen. Grün ist die geheimnisvollste aller Farben und sie beschließt wie ein Hauch das Ende des zweiten und sechsten Satzes.
Das eruptive Rot wogt im II. Satz auf 150 Takten auf und ab, leuchtet und wärmt das Blau und Grün: im Aufstieg dieser kleinen Geschöpfe Munzo (Takt 16 ff) und Dodo (Takt 56 ff) liegt etwas leichtes, Unschuldiges - Berg läßt die Musik schweifen und geht dem Vergnügen der Kindheit mit einer schüchternen Freude entgegen. Wie es hupfelig klingt! Bewegt vom Muttersingsang Hannas ist er für die Zeit einiger Schritte selbst eine Art Kind. Mit der flüchtigen Schwingung von den kaum noch wahrnehmbaren Pizzicato Noten C-C endet nach 150 Takten (,,[15] x 10 Takte") der tastende Griff nach der Mutter Kind-Idylle; zart, hauchdünn setzt Berg ans Ende des 11. Satzes in grüner Tusche die Anmerkung „Wie aus der Ferne: Do-do."[227] Leise und leiseste Töne - Berg: ein Fetischist des Piano.
Der schönen grünen Dorothea wird das Glück zuteil, die dekorative Partitur nach dem Tode der Mutter in Händen zu halten.[228] Grün geht durch alles durch und grünt und blendet: In Takt 77 ist die Vortragsbezeichnung doIce und in Takt 79 doIciss grün unterstrichen: Musik als Zaubertrank wie ihn Shakespeare im Sommernachtstraum mischte, Musik wie der Blumensaft, den Puk und Oberon im Athener Wald verabreichen: ,,Eine Musik, die glaube ich, die schönste ist, die ich je schrieb."[229]
Der Jüngling Alban Berg hat die Bilderwelt Giovanni Segantinis begierig eingesogen: Hier kreisen die Archetypen der Mütter im piktoralen Feld. Segantini endet bei der „Bösen Mutter",[230] als Jugendstilmotiv den „Lesbiennes"[231] Charles Baudelaires eng verwandt. Bergs Werk wird eine Pendelbewegung zwischen der Mutter und der Hure[232] werden. Die eine siedelte er in der „Lyrischen Suite" und in „Wozzeck" an und die andere wird zu „Lulu".
Zu einem „Ziehharmonika-Erbauer"[233] in der Neubaugasse ist Alban Berg im Sommer des Jahres 1921 unterwegs, um hier die Physis des Instrumentes mit der an- und ab schwellenden Luft zu erkunden. Es drängt ihn nach der drolligen Sprache der Wirts hausmusik, die er in „Wozzeck", II. Akt,[4]. Szene mit „Fiedel, süsse Hölzel, Ziehhar monika, Gitarre und Basstuba" pulsieren lassen wird.[234] In den handschriftlichen Frag menten[235] Georg Büchners zu „Woyzeck", mit der oft bis zum Gekritzel sich verkleinern den Schrift und den eingestreuten Zeichnungen, heißt der Held auf zwei Bögen „Louis" und seine Geliebte „Margreth", auf den anderen „Franz" und „Louise". Büchners lose Folge von Szenen gruppierte Alban Berg in der Oper „Wozzeck"[236] zu 15 Szenen in 3 Akten. ,,Friedrich Johann Franz Woyzeck, Wehrmann, Füsilier im 2. Regiment,[2]. Batail lon,[4]. Kompagnie, geboren Mariä Verkündigung", ist „30 Jahr,[7] Monat und 12 Tage"[237] alt. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche und liebt dessen Mutter „Marie", die die Bibel in höchster Verzweiflung anrufen wird: ,,Heiland! Heiland! ich möchte Dir die Füße salben!"[238]
Der Name „Marie" verleitet uns an die Jungfrau Maria und an die lehrreichen Verkündigungsbilder zu denken. Im Lukasbericht 1,[27] heißt es: ,,Et nomen virginis Maria", ,,und die Jungfrau hieß Maria". Die Exegeten[239] beginnen mit der Etymologie. ,,Maria" bedeu tet auf hebräisch Meerstern (stel/a maris), womit präfiguriert wird, daß die Jungfrau die sündige, aber reumütige Menschheit stets führen wird, so wie der Meerstern dem Steuermann im Sturm den Weg weist. Im Syrischen bedeutet „Maria" sowohl Braut wie Herrin (domina) und in der Tat ist Maria zugleich Braut und Mutter Gottes.[240] Und wenn das Wort „Maria" so sehr dem Wort myrrha gleicht, so offenkundig, um anzudeuten, daß der Körper der Jungfrau denjenigen Christi nicht nur aufs Geborenwerden, sondern auch aufs Sterben vorbereitete, stirbt er doch gesalbt mit Myrrhe, mit bitterer Myrrhe (myrrha amara) auf seiner Haut.[241] Albert der Große hielt sich allein an die Buchstaben aus denen sich der Name der Jungfrau zusammensetzt: So vereint Maria in sich alle virtuellen Qualitäten des M (Mutter, Mittlerin), des A (Alleviatrix-Trösterin, Arche aller Schätze), des R (Regina-Königin, Reparatrix innocentiae - Wiederherstellerin der Un schuld), des 1 (nluminatrix-Erleuchterin, aber auch /aculum - der Speer, der gegen Satan geschleudert wird) und noch einmal des A (Auxiliatrix-Helferin, Advocata nostra - unsere Fürsprecherin bei Gott).[242]
Religiöse Maler wie Fra Angelico, Giotto,[243] Pietro Lorenzetti, Carlo Crivetti und Giovanni Bellini haben aus ihren Werken wahre Exegesefelder gemacht. Die großen Exegeten der Verkündigung waren Theologen der dominikanischen und franziskani schen Tradition, Albert der Große und Thomas von Aquin einerseits und andererseits Bonaventura und Donus Scotus. Unter den vielen tausend Seiten umfassenden theologischen Schriften des Mittelalters, findet sich bei Albert dem Großen ein gelehrtes Werk mit dem Titel „De laudibus Beatae Mariae Virginis"[244]. Albert der Große, der Begründer des christlichen Aristotelismus, hat hier ein ausschweifendes Logbuch geschrieben, in dem sämtliche mögliche Figuren - Orte der Jungfrau Maria dargelegt werden.
Fünfzehn Verkündigungsszenen hat der Dominikanermönch Fra Angelico[245] gemalt. Im Kloster von San Marco in Florenz treffen wir im Nordkorridor auf ein Verkündigungsbild, das zwischen 1438 und 1450 entstanden ist. Der Gläubige genießt in der Abgeschiedenheit des Ortes die schillernde Kalkmalerei des Quattrocento.[246] Wir sehen Maria: Die Horchende, die vom Engel Angesprochene. Der Apostel Paulus verkündete: ,,So kommt der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort (per verbum), das Wort Christi." ("Römerbrief" 10,[17]). Das Säulen-Haus der Jungfrau ist von Zypressen, Zedern und Myrrhe umgeben und ein Bretterzaun begrenzt einen Blumengarten - hortus conclusus[247] - in dem weiße und rote Blumen blühen, rubea et lactea,[248] rot und milchig - wie die Wangen Marias. Diese Blumen, sagt die Exegese sind Christus und am Tag der Verkündigung, am 25. März, erblüht die Menschheit Christi. Die Verbindung von Rot und Weiß weist auch darauf hin, daß insbesondere die Geburt wie auch der Tod Christi unter dem Zeichen des Wassers und des Blutes, des Reinen und des Befleckten, des Leinentuches und der Wunde stehen. Thomas von Aquin hat die Figur des Blumen-Christus wie folgt beschrieben: ,,Der Blumen-Christus ( fIosChristus ) erblühte in der Geburt, wovon man bei Jesaja (11,[1]) liest: ,Und eine Blume wird hervorgehen aus seiner Wurzel.' Er verblühte in der Passion, als die sichtbare Schönheit von ihm wich (... ). Und er erblühte wieder in der Auferstehung, in der er seine zuvor verblühte menschliche Natur zurückgewann. Deshalb heißt es: ,Und sein Fleisch blühte wieder' (Hiob,33,[25])".[249] Wenn der gefiederte Bote Gottes, der Engel Gabriel, zu Maria „Dominus tecum"[250] sagt, erhebt er die Jungfrau, wie Albert der Große angibt, zur Braut und Mutter Gottes. Für den frommen Menschen hat Frau Angelico in das Verkündigungsbild auch eine Buchstaben-Botschaft eingeschrieben, um das Mysterium der jungfräulichen Mutterschaft zu preisen: VIRGINES INTACTE CUM VENERIS ANTE FIGURAM PRETEREUNDO CAVE NE SILEATUR AVE. ,,Wenn du vor die Figur der unberührten Jungfrau kommst, gib beim Vorbeigehen acht, daß du das AVE nicht stillschweigend übergehst."[251] Der fanatische italienische Marienkult wurde moralpolitisch instrumentalisiert, als Papst Pius IX. 1854 die unbefleckte Empfängnis Mariae zum Dogma erklärte.
Aus gänzlich anderen Worten ist das Büchnerfragment „Woyzeck" gedrechselt. Hier predigt ein Handwerksbursch auf dem Tisch einer Wirtshausbude: ,,Aber alles Irdische ist übel, selbst das Geld geht in Verwesung über. Zum Beschluß, meine geliebten Zuhörer, laßt uns noch übers Kreuz pissen, damit ein Jud stirbt."[252] Alban Bergs Oper „Wozzeck" folgt in Takt 630 nur der ersten Zeile dieser Rede und im Gejohle der Menge wird der Trunkenbold abgeführt. Branntwein ölt die Kehlen der ordinären Burschen und Soldaten, sie greifen im Tanz nach dem erhitzten Gesinde und sie singen mit Courage schlüpfrige Lieder: ,,Ein Jäger aus der Pfalz Ritt einst durch einen grünen Wald! Halli, Hallo! Halli, Hallo! Ja lustig ist die Jägerei, Allhie auf grüner Haid! Halli, Hallo! Halli, Hallo! (Takt 560ft, II Akt,[4]. Szene) (... )0 Tochter, liebe Tochter, Was hast Du gedenkt, Daß Du Dich an die Kutscher Und die Fuhrknecht hast gehängt?!" (Takt 575ft,[11],[4].) Eng an die Stier-Brust des Tambourmajor ist Marie geschmiegt und der Kerl dreht das Weibsbild im Walzertakt „Immer zu, immer zu!" (Takt 505, II,[4].) Wozzeck wird rot vor den Augen: ,,Dreht Euch! Wälzt Euch! Warum löscht Gott die Sonne nicht aus? Alles wälzt sich in Unzucht übereinander: Mann und Weib, Mensch und Vieh! Das Weib ist heiß! ist heiß! heiß! Wie er an ihr herumgreift! An ihrem Leib! Und sie lacht dazu ... " (Takt 514ff, II,[4]).
Auf offener Straße, in der Abenddämmerung ist das Begehren der Kindsmutter Marie erwacht. Die 5. Szene im 1. Akt der Oper „Wozzeck" fokussiert die physische Raserei mit dem Tambourmajor, ,,sie ringen miteinander. Tambourmajor: ,Wildes Tier!' Marie reißt sich los: ,Rühr mich nicht an!' Tambourmajor richtet sich in ganzer Größe auf und tritt ganz nah an Marie heran (eindringlich): ,Sieht Dir der Teufel aus den Augen?!' er umfaßt sie wieder, diesmal mit fast drohender Entschlossenheit. Marie: ,Meinetwegen, es ist Alles eins!' sie stürzt in seine Arme und verschwindet mit ihm in der offenen Haustür".
Intensiv-Werden, Tier-Werden. Es ist hinlänglich bekannt, daß die Literatur des Naturalismus das „Tier im Menschen" (Emile Zola)[253] hervorgehoben hat und seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert die Projektion der Frau als „schönes Tier"[254] eine bemer kenswerte Konjunktur erfahren und bei Frank Wedekind eine poetische Verdichtung erreicht hat.
Nach Frank Wedekinds Dramen „Erdgeist" und „Die Büchse der Pandora" komponierte Alban Berg „Lulu", er arbeitete daran zwischen 1928 bis zu seinem Tod im Winter 1935.[255] In ein und derselben Bewegung, in der des Dramatischen und Musikalischen reflektieren Wedekind und Berg die Windungen und Drehungen der weiblichen Libido. Lulu,[256] dieses Konstrukt aus Männerphantasien, das mörderisch auf seinen Schöpfer zurückschlägt und der Begradigung des Begehrens zu entgehen vermag, erliegt schließlich dem vor ihr aufgerichteten Todesbild. - In Jack the Ripper findet Lulu ihren erlösenden Schlächter.
Den unbändigen Lust: Todesschrei Lulus setzt Berg in der Oper „Lulu" in Takt 1294, III. Akt,[2]. Szene. Mit der Stimme im Zustand der Erektion schließt die lesbische Gefährtin Lulus, Gräfin Geschwitz, den Todesreigen. Was Marquis de Sade als Prinzip des Zart gefühls bezeichnete, materialisiert Berg in den Takten 1315-1 (III,[2]): ,,Geschwitz:, Lulu mein Engel! Laß dich noch einmal sehn! Ich bin dir nah! Bleibe dir nah, in Ewigkeit' (sie stirbt)" wellenhaft sich biegend wie ein Schwan. Mit einem „tristanisch unaufge lösten Quintsextakkord"[257] endet das Liebesgebet. Den Weg in den Somnambulismus oder die Einsamkeit, den Wahnsinn oder den Tod sind zahlreiche Heroinen der roman tischen Oper gegangen. Die leisen und flötenhaften Töne für jede Empfindung liebender Herzen hat Richard Wagner mit „Tristan und lsolde" etabliert. Das Hohe Lied auf die alles überbordende hyperklassische heterosexuelle Paar-Energie, die die Oper des 19. Jahrhunderts prägt, hat Berg empfindlich relativiert. Wie Meuterer nach tagelanger Verschwörung einen befestigten Platz sich zu eigen machen, so fixiert Alban Berg den lesbischen Eros im Musiktheater des 20. Jahrhunderts.Berg, der vor den dumpfen Instinkten der Masse zitterte, hat nie an einem ungehobelten Tisch gesessen: So viele Teppiche sind über die Schwelle gelegt und die süßen Aromen der Blüten schwängern die Luft der bürgerlichen Stube. Sein sensibles Ohr verstopft Berg nächtens mit Kügelchen,[258] doch als Horchender mischt er sich in „Wozzeck" unter die Hefe des Proletariats, und in „Lulu" starrt der Libertin in die von Absinth glasig schimmernden Augen der Hure, die die Sinne der Metropolen zur Explosion brachte. In der Opernrevolte Bergs - mit dem betäubenden Orchester[259] und den bezaubernden Stimmen - verschwinden die Kulissen des Elends lautlos im Schnürboden, während die sich ständig vergrößernde Masse der Bedürftigen und Entwurzelten, die die berstenden Städte durchkreuzen, die pechschwarze[260] Seite der Moderne zeigt. Im Juli des Jahres 1927 beginnt die Kaiserstadt Wien Feuer zu fangen, es riecht nach dem blutigen Gräuel eines Bürgerkrieges, der Justizpalast brennt lichterloh. Berg schreibt indessen unter freiem Himmel inmitten von Almrausch die Lyrische Suite zu Ende.
Die Jahreszeit gehört zu den Kondensatoren der Gefühle, aber auch die Geschwin digkeit oder Langsamkeit einer Bewegung. ,,Im wunderschönen Monat Mai,/" jubelt Schumann, ,,als alle Knospen sprangen,/ da ist in meinem Herzen/ die Liebe aufge gangen./ Im wunderschönen Monat Mai,/ als alle Vögel sangen,/ da hab ich ihr gestan den/ mein Sehnen und Verlangen".[261] Mai-Wiese in den Augen, Blumen im Blick,20 Mai 1925: Stündliche Träumereien, Zerstreutheit, nervöse Erwartung - die „Wozzeck" Bruchstücke werden in Prag aufgeführt. Dieser Tag unter tausenden von Tagen, wenn die Luft warm ist wie ein Vogel in der Hand, drängt in höchste Gefühlsstürme.
Das kleine Herz[262] Bergs klopft und pocht, die Adern und der Atem schwellen an, die Adern treten an den Schläfen hervor, die Adern der Scham überfließen. Die Sprache der Liebe ist ein Flüstern, Lispeln, Kichern, Glucksen, Jauchzen. Bergs lauschendes Ohr[263] ist ein Trichter, in der das Helle und Dunkle, Laute und Leise dekodiert werden. Öffnen wir die Widmungspartitur. Im strahlenden Tintenrat leuchtet am Beginn des III. Satzes die Magie des Datums: ,,20.5.1925, denn noch war alles Geheimnis - uns selbst Geheimnis... "[264] In dem aus „3 x 23 Takte" bestehenden Teil des Allegro misterioso ist der Takt 34f. mit der Anmerkung „wie ein Geflüster" sowie der Takt 37f. ,,wieder wie geflüstert" gekennzeichnet. Auf Takt 70 folgt das Trio estatico „plötzlich ausbrechend", das auf Takt 92 (,,[4] x 23 Takte") wieder abbricht, die Wiederholung des Allegro misterioso vermerkt Berg mit „plötzlich wieder wie ein Geflüster".
Im III. Satz erscheint also das Nachbild eines Flüsterns - nichts als dieses Flüstern im reglosen Raum. Es ist das Hineinhorchen in die Stille. Da ist das Subjekt der Lust, das in der Nähe Hannas ein Schwindelgefühl erfährt: Das drängende Flüstern der Hitze der Begehrlichkeit. Es ist spannend, zu erleben, wie Berg immer wieder dort, wo er erotische Motive abhandelt, schnell zu besessen Versuchsreihen gelangt, in denen er ein von Obsessionen zusammengesetzes Tonnetz flicht, das den Hörer süchtig machen kann.
Hannas Haus in Prag-Bubenec Nr. 593 ist der Ort der visuellen und akustischen Phänomene. Es kann hierin zum Schweigen, aber auch zum Gesang oder zum Schrei kommen. Es ist der Ort des Wechsels von Sonne und Mond, Licht und Schatten. Es kann des weiteren das Gedächtnis und das Vergessen, das Leiden und die Hoffnung lenken.
Magie des Datums, Magie des Ortes, Magie der Stunde. Zwei detailreiche Ansichten seines Ateliers[265] hat Alberto Giacometti 1932 für eine junge Dame aus dem römischen Adel gezeichnet. Kugelige, kegelartige Gebilde, Käfige und Gerüstbauten aus Holz, Gips und Eisen bilden das Interieur von Giacomettis Atelier in Paris, Rue Hippolyte Maindron 46. Der Raum war etwa viereinhalb Meter breit und tief, die Doppeltüre mit dem Briefkasten ging auf die Strasse hinaus, doch war sie immer verschlossen und verstellt gewesen. Man trat durch die schmale, hohe Türe - aus einem engen Vorhof kommend - ins Atelier. Im Ganzen waren neunzehn Skulpturen aufgestellt, darunter das Werk „Die Stunde der Spuren". Es besteht aus einem Raumkasten, in dem ein gipser nes Herz pendelt. Darüber spreizt sich - aus Holz, Drahtstäben und Gips modelliert - ein phallisches Objekt, das in die leere stößt.
Auf einem Modellierblock im Zentrum der fragilen Bleistiftzeichnung ist auch ein höchst zerbrechliches Gebilde aus dünnen, mit Gips überzogenen Stäben auszumachen, Giacometti gab der Arbeit, die einer Streichholzbastelei ähnlich sieht, den Titel: ,,Der Palast um vier Uhr früh". Brassai hat die stummen Objekte fotografiert und eine Doku mentation des staubigen Atelierbestandes ist im Jahre 1933 in der Zeitschrift „Documents" erschienen. In einem begleitenden Text hat Giacometti den „Palast" der Morgenfrühe in Beziehung zu sechs glücklichen Monaten mit der Geliebten „Denise" gebracht. Doch der „Palast" entzieht sich einer eindeutigen Entzifferung, einzig die magische Stunde winkt einem. Blicken wir noch in die rechte Ecke der Atelierzeichnung: hier steht zu Füssen der „Löffelfrau" ein Rhomboid-Käfig, in dem eine an Fäden verspreizte Figur in der Luft balanciert. Über den Verbleib der Arbeit wissen wir nichts, doch eine Analogie zu dieser Skulptur weist ein aus dreizehn Flächen bestehender polyedrischer schiefer Stein auf. Im „Minotaure" war die Gipsplastik 1934 unter dem Titel „Pavillon nocturne" abgebildet. Albert Giacometti verwies später auf die Herkunft des Polyeders aus Dürers Kupferstich „Melancolia 1"[266] und im Jahre 1938 begann Giaco metti auf die obere Seite des „Kubus" sein Selbstporträt einzugravieren.
Es ist als schlüpfe Alban Berg in die Hand eines Kalligraphen des fernen Ostens[267] oder in einen Buchmalermönch des Mittelalters, um illuminierte Initialen in den Notenberg des III. Satzes zu pinseln. Der Name, der sowohl Wort als auch Körperlichkeit darstellt, wird zum Ton. Alban Bergs und Hanna Fuchs aneinandergeschmiegte Initialen AB HF durchziehen wie eine Karawane die Seiten 36 bis 45 im 111. Satz der Widmungspartitur. In den Zwölfton-Reihen erlaubt Alban Hanna immer neue Stellungen einzunehmen: in dem herrlichsten Körper, den sie je angenommen hat, ertönt Hanna. Der Ton-Akt erfolgt durch Visualisierung. Die Buchstaben H F im Verbund mit A B sind als fahlrote Flammen unter die Töne h f abgesetzt - Hanna werden Töne einerseits angezeigt, andererseits kann sie buchstabieren, Laute bilden: denn der Raum des Alphabetes ist lautlich und der Buchstabe ist der Ort, an dem alle graphischen Abstraktionen zusammenlaufen.
,,Jede Schrift[268] beginnt mit dem einzelnen Strich" merkt Paul Claude! an, ,,beziehungs weise der einzelnen Linie, die in ihrer Kontinuität das reine Zeichen des Individuums ist. Entweder ist die Linie also horizontal wie alles, was in der Einhaltung eines Prinzips eine hinreichende Daseinsberechtigung findet; oder sie ist vertikal, wie der Baum und der Mensch, zeigt die Tat an und stellt die Behauptung auf; oder sie ist schräg und markiert die Bewegung und den Sinn." Der katholische Dichter Claudel gibt den vertikalen Linien einen optimistischen, voluntaristischen, humanistischen Sinn. H undFsind durch ihre einfache scharfe Vertikale demnach Ausdruck einer „unverletzlichen Geradheit". Der BuchstabeBzeigt die Rundheit des Lebens an. F hat zwei Schenkel und der Buchstabe blickt nach rechts zu A. A stehtBgegenüber. Den BuchstabenAkennzeichnen zwei Schrägstriche die miteinander durch eine kurze Horizontale verstrebt sind: Schrägen markieren die Bewegung.
Berg macht Hanna den reinen anmutigen Buchstaben zum Geschenk - in der „Lyrischen Suite" mutieren Hanna und Alban demzufolge zu Ton-Buchstaben. Das Verknüpft bleiben von HF mit AB simuliert Berg im Ton- und Buchstabenraum der Widmungs partitur. Runde und spitze Buchstaben, einzelne und mehrere Wörter mischen und vermengen sich in Takten mit Tönen. Der Drucklegung[269] der Taschenpartitur der Lyrischen Suite gingen viele Korrekturen voraus. Betrachtet man den langwierigen, ein Jahr dauernden Prozeß mit dem Alban Berg von der anfänglichen Komposition zur vollendeten, pulsierenden Zwölftonreihe gelangte, so stellt sich die Frage, was suchte er, intuitiv in diesem Prozeß? Er suchte eine Gestalt, die die vergängliche, lebendige Form der Liebe, die er vor Augen hatte, auf Dauer eingravieren würde.
Im Blick zurück tauchen andere kolossale Liebesgravuren auf, insbesonders stille Bäume[270] dienten mit ihren Einritzungen als Gedächtnisstelle des Begehrens. Der Topos der Bauminschrift durchzieht schon die hellenistische Spätantike, Kallimachos gebraucht das Bild von der Rindenschrift in seiner Lyrik als erster. Sextus Propertius,[271] der Klassiker der römischen Elegiendichtung aus Umbrien hat es von ihm übernommen und auch Ovid. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert[272] häufen sich die Beispiele in Malerei und Grafik. Berühmte Liebespaare wie Paris und Oenone,[273] Medor und Angelika haben Giovanni Francesco Barbieri,[274] Jacques Blanchard,[275] Julius Schnorr von Carolsfeld[276] oder Claude Lorrain[277] zu Federzeichnungen, Gemälden und Fresken angeregt. Die Inszenierung des Begehrens in der Natur durchzieht auch die Literatur der deutschen Klassik und Romantik.
„Ich war, nach Menschenweise, in meinen Namen verliebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete Leute zu tun pflegen, überall an. Einst hatte ich ihn auch sehr schön und genau in die glatte Rinde eines Lindenbaumes von mäßigem Alter geschnitten. Den Herbst darauf, als meine Neigung zu Annetten in ihrer besten Blüte war, gab ich mir die Mühe, den ihrigen oben darüber zu schneiden. Indessen hatte ich gegen Ende des Winters, als ein launisch Liebender, manche Gelegenheit vom Zaune gebrochen, um sie zu quälen und ihr Verdruß zu machen. Frühjahrs besuchte ich zufällig die Stelle, und der Saft, der mächtig in die Bäume trat, war durch die Einschnitte, die ihre Namen bezeich neten, und die noch nicht verharscht waren, hervorgequollen und benetzte mit un schuldigen Pflanzentränen die schon hart gewordenen Züge des meinigen. Sie also hier über mich weinen zu sehen, der ich oft ihre Tränen durch meine Unarten hervorgerufen hatte, setzte mich in Bestürzung." (Johann Wolfgang v. Goethe, ,,Dichtung und Wahrheit", zweiter Teil,[7]. Buch)
Der Baum des Duftes, der Lindenbaum und das Schnitzmotiv ist durch Schuberts Liedzyklus „Die Schöne Müllerin"[278] populär geworden. Das siebte „Ungeduld" über schriebene Lied mit der Strophe: ,,Ich schnitt' es gern in alle Rinden ein", findet eine eisige Entsprechung in der „Winterreise" ,[279] wo es im siebten „Auf dem Flusse" betitelten Lied heißt:
Der du so lustig rauschtest, Du heller, wilder Fluss, Wie still bist du geworden, Gibst keinen Scheidegruß. Mit harter, starrer Rinde, Hast du dich überdeckt, Liegst kalt und unbeweglich Im Sande ausgestreckt.
In deine Decke grab ich Mit einem spitzen Stein
Den Namen meiner Liebsten Und Stund und Tag hinein;
Den Tag des ersten Grußes Den Tag, an dem ich ging:
Um Nam und Zahlen windet Sich ein zerbrochner Ring.
Mein Herz, in diesem Bache
Erkennst du nun dein Bild?
Ob's unter seiner Rinde
Wohl auch so reißend
schwind?
Am Schluß einer langen, historischen Nahrungskette stößt Berg die Silben H und F aus. Der Raum in dem seine Hand sie entstehen läßt, ist der Tonraum der „Lyrischen Suite". Dafür zimmert er eigens einen Zwölf-Ton-Raum. Vor der Tonalität scheut er gar nicht zurück, doch vor den Dissonanzen. Sein Es ist angegriffen, Fetzen treiben. In der Komposition wird er sie nach und nach wieder zusammenfügen müssen, da sein Körper an der Grenze seiner Dehnung angelangt ist. Wenn er die Notwendigkeit verspürt in der TonzeichnungHundFeinzugravieren, so unterstützt er damit die serielle Anordnung der Töne und den Rhythmus des inneren Aufbaus des Streichquartetts.
HANNA: dieses fünfsilbige Wort schmilzt im Munde in dem Augenblick, da er es formt. Jeder Buchstabe ist ein kleines Wesen: ,,Du, die in meinen endlosen Träumen wohnt, ... Einzig- und Ewiggeliebte. "[280]
An diesem Punkt sei das Abschweifen in ein anderes Mikrogramm gestattet, das in Gottfried Kellers Schriften zu finden ist. Hinzuweisen ist auf die kolossale Kritzelei, die der grüne Heinrich[281] eines Tages in einer Anwandlung von Schwermut auf einem großen Karton auszuführen beginnt und an der er jeden weiteren Tag mit unzähligen Federstrichen fortzeichnet, bis ein ungeheures graues Spinnennetz fast die ganze Fläche bedeckt. ,,Betrachtete man", schreibt Heinrich Lee, ,,das Wirrsal genauer, so entdeckte man den löblichsten Zusammenhang und Fleiß darin, indem es in einem fort gesetzten Zuge von Federstrichen und Krümmungen, welche vielleicht tausende von Ellen ausmachten, ein Labyrinth bildete, das vom Anfangspunkt bis zum Ende zu ver folgen war(...) Nur hier und da zeigten sich kleinere oder größere Stockungen, gewisse Verknotungen in den Irrgängen meiner zerstreuten gramseligen Seele, und die sorg same Art, wie die Feder sich aus der Verlegenheit zu ziehen gesucht, bewies, wie das träumende Bewußtsein in dem Netze gefangen war (... )"[282] Die Beschreibung des hoch gradig melancholischen Kritzelwerkes erinnerte den Schriftsteller W. G. Sebald an die blauen Papierbögen, die Gottfried Keller, als er in Berlin an seinem Bildungsroman saß, zur Unterlage benutzte und auf die er den Namen seiner unerwiderten Liebe in langen verschlungenen Linien, Spiralen, Kolonnen und Schlaufen in vielhundertfacher Variation festgehalten hat - Betty Betty Betty, BBettytybetti, bettibettibetti, Betty bittebetti heißt es da in jeder nur denkbaren kalligraphischen Ausformung.
Was bedeuten solche Überschneidungen und Korrespondenzen? Handelt es sich nur um Vexierbilder der Erinnerung? Alban Berg ist gewiß nicht der erste Komponist, der seine fragile Kunst dem unendlichen Raum der Erinnerung abringt. Berg ist für seine Bewunderer nicht zuletzt der beispielhafte Tonsetzer für ein akribisches Sich-Erinnern, für ein versteckt-offenes autobiographisches Schreiben. Mit der „Lyrischen Suite" ist eine Art Verlustbilanz eines Liebeslebens notiert, Hanna Fuchs-Robettin wirkte an dem Werk gerade durch die Distanz mit, in der sie sich hielt. Entstanden ist so ein hochkomplexes Liebes-Dokument, ein Traum-Büchlein für Hanna: ein glücksbringendes Amulett.
Alban Berg ist es gelungen, eine ästhetische Konstruktion zu schaffen, die sich bestens dafür eignet, biographische und musikalische Strukturen in eins zu blenden. Von Hanna verlangt Berg die Arbeit des Horchens und Sehens vom Zusammenbauen von Klängen und Texten. Berg breitet vorsichtig, aber hartnäckig ausführlich sein Material aus, wie Fußnoten durchzieht Bergs Text und sein graphisches Schlingwerk den Notenhaufen. Die Widmungspartitur der Lyrischen Suite ist ein einmaliges Befestigungswerk, in welchem die kleinsten und unschuldigsten Dinge gerettet werden sollten vor der „Zerlösung der Wirklichkeit" (Jean Amery). Mit seismographischer Präzision verzeichnet Berg die Erschütterungen am Rand seines Bewußtseins, registriert Kräuselungen in seinen Gedanken und Emotionen und entwickelt dafür einen eigenen spröden Tonraum.
Hanna Fuchs und Alban Berg waren so etwas wie eine Doppelgestalt. Einander herziehend, einander nachziehend, einmal er sie, dann wieder sie ihn. Das Glück des Geschehenlassens, das größte Glück. Die schöne Liebe von Alban Berg hat gewonnen, einen wogenden Aufflug nimmt die erotische Energie im IV. Satz, Adagio appassionato. Magnet an Magnet sind die Töne aneinander geschichtet. Musik in der Art eines ver weilenden Streichelns. Der Satz wird mit „Tags darauf"[283] überschrieben. Im strahlenden Purpurrot leuchten ab Takt 24 bis in Takt 62 die Eintragungen des Minnesängers: ,,Ich und Du/ Du u. ich/ Du und ich/ Immer Du/ Ich: ,Du bist mein eigen, mein eigen'/ Nun sagst es auch Du: ,Du bist mein eigen, mein eigen - - - - u. noch einmal - - - und verebbend - - - - - - - ins - ganz Vergeistigte, Seelenvolle, überirdische "
Man sagt, Dante Alighieri stand in einem Lorbeerwalde sechzehn Jahre und wartete auf Beatrice. Es ist die Stärke, die andauert! Ende des 17. Jahrhunderts erhält ein Bild, das wohl 1515 aus der Hand Tizians entstand, den Titel „Amor Divino ed Amor Profano"[284], die himmlische und die irdische Liebe. Auf dem Rand des Brunnens, der einem antiken Sarkophag gleicht, sitze zur Rechten, mit einer Öllampe in der erhobenen Hand, die nackte göttliche Liebe oder die Caritas, in der Mitte schöpft ein Putto Wasser, die bekleidete Figur zur Linken, mit einer verblühenden Rose auf dem Schoß, sei die irdi sche Liebe. Auch Max Ernst betitelte ein Frühwerk „Himmlische und irdische Liebe" (1923/24) und als verliebter Gymnasiast malte er 1907 eine Spätsommerwiese mit Apfelbäumen - in Erinnerung an Hanny Peters kerbte er ein Herz und deren Initialen im vorderen Baum des Gemäldes ein.
Eine der sublimsten Liebesszenen in der Geschichte der abendländischen Malerei hat Correggio, genannt Antonio Allegri (1498-1534) in Szene gesetzt. Das Gemälde, betitelt „Jupiter und lo",[285] um 1530 entstanden, hatte Alban Berg als Reproduktion an seine Zimmerwand geheftet. Im Buch 1, Vers 568-750, ,,Metamorphosen"[286] erzählt Ovid die Geschichte von lo, Geliebte des luppiter.
Aus dem Schatten des Waldhaines lockte der Himmelsgott luppiter die Quellennymphe lo. Aus Wolkenrändern lässt der anarchistischste aller antiken Götter Nebelschwaden auf die Fliehende herabrieseln. Das Feuchte des Nebeldunstes markiert den Beginn einer Schändung, die zum libertinen Vorhaben gehört. Correggio, der geniale Wolken Bildhauer malte eine schockierende Hingabe an die Ausschweifung in Steinblau. Aus der Hand desselben Malers stammt auch eine der schönsten Rötelzeichnungen, ge nannt „Eva reicht den Apfel". Jean Starobinski, der eine detailreiche Rousseau- und Montaigne-Studie sowie eine „Kleine Geschichte des Körpergefühls" vorlegte, hat in der Louvre-Ausstellung „Gute Gaben. Schlechte Gaben" die „Eva"-Zeichnung[287] des Correggio ins Zentrum gerückt: Er schreibt: ,,Der köstliche Geschmack hat den Gaumen überrascht. Der Arm streckt sich aus. Die Hand, die den Apfel gepflückt hat bietet sich schon dar. Die Finger halten den Apfel, werden sich aber bald öffnen (... ) Das Wunder dieser Zeichnung gründet darin, daß der dargereichte Gegenstand sich nicht unter scheidet von den lächelnden Lippen, von der nackten Haut, von dem Arm, die die Gabe anbieten. Die Frucht und die Gestalt gehören so sehr zueinander, daß sie eine einzige Gabe bilden. Die Wonne läßt das Gesicht der Frau aufleuchten, die vom Apfel gekostet hat und die ihn zum Teilen darreicht. Sie schämt sich nicht, noch weiß sie nicht, dass sie sich mit der Gabe selbst gibt."[288] Wessen Schritte nach Parma gelenkt werden, wird der „Eva" in der freskierten Kuppel der Kathedrale wieder begegnen.[289]
So wunderbar weiblich musiziert Berg. Die Musik sprudelt hervor wie etwas, das erfüllt ist von einer Verkündigung. Bergs Musik schwingt im IV. Satz wie Vögel der Venus zwischen Himmel und Erde, Berg malt das „Liebesbewußtsein zur großen unendlichen Liebesleidenschaft"[290] aus. Dank dieser Verzauberung setzt er die Metaphysik der Liebe in Gang und lotet sie mit einer endlos vibrierenden und aufopfernden Behutsamkeit aus. Das, was diese 69 Takte wie nie zuvor in der Tonkunst durchwühlen, endet wie im Prestissimo der Fis-Dur Sonate, der Alexander Scriabin ein eigenes, mystisches Programm-Gedicht[291] beigab. Die Vereinigungsszenen, die Berg im IV. Satz, Adagio appasssionato, mit solcher Hingabe sich ausmalt, sind nicht nur unter den schönsten der Musikliteratur, sie sind einmalig auch, weil in ihnen die imaginierte Vollendung der Liebe gepriesen wird.
Liebe ist ein Rauch, der heute in der Luft kreist und morgen verschwunden ist. Erloschen sind dann die Feuer der Blumen, geschlossen ihre Augen. Wesen Seele dafür gestimmt ist, Bergs Botschaften entgegen zu nehmen, kann im V. Satz ein radiographisches Dokument der Angst erkennen. Ins Auge fällt die Anheftung eines delirierenden Textes an das schwarze Notengewusel und alle Nerven einer wundge riebenen Seele liegen hier blank. Zu Beginn des V. Satzes, Presto delirando auf Seite 57 der Taschenpartitur sinkt von links oben ein rot gepinselter Wortschwall über die ganze rechte Seite nach unten, schlängelt sich durch das Weiss an der Seitenunter kante nach links, um in einem Bogen die Takte 15, 16, 17 und 18 zu durchkreuzen, und um schließlich in Takt 460 zu enden. Das ist Umbra, der Schatten: Finsternis. Der Schatten ist imstande, die friedlich - bisweilen freundlich geschriebenen Töne - zu verdunkeln.
Die Lyrische Suite ist eine Art Waage, auf deren einer Schale das Glück des Lebens liegt, auf der anderen der Schmerz. Die ständig wechselnden Perspektiven der Lust, die in der Quartettsuite eingeschrieben sind, verebben im V. Satz: ,,Dieses Presto delirando kann nur verstehen, wer eine Ahnung hat von den Schrecken und Qualen, die nun folgten. - Von den Schrecken der Tage [Takt 15] mit ihren jagenden Pulsen, [19] [51] von dem qualvollen Tenebroso der Nächte, mit ihrem kaum Schlaf zu nennenden Da hin dämmern - - - - [70] / [121] Und wieder Tag mit seinem [124] wahnsinnig gehetzten Herzschlag [127].( ... ) [201] Als möchte sich das Herz beruhigen [210] - - - - - - [211] di nuovo tenebroso mit ihren, die qualvolle Unruhe kaum verhaltenen schweren Athem [230] zügen [231] - - - - - - [262] als ob sich für Augenblicke der süße Trost eines [274] wirklichen - - - alles vergessenden Schlummers über [283] Einern senkte - - - - - [306] Aber schon meldet sich [311] das [312 ] Herz - und [320] wieder [321] Tag und [324] - - - - - [330] so - - - fort - - - [369] ohne [370] Stillstand [371][409] dieses [41O] Delirium [411] - - - - - - - - - - [445] ohne [446] Ende [447][460]"[292]
Bei Berg bewegt und erregt das Schlafwandlerisch-Sichere, mit dem er über den Abgrund, der sich unter ihm aufgetan hat, auf einem Hochseil aus nichts als Tönen hinwegtanzt. Er weiß, dass die meiste Musik aus der Untröstlichkeit kommt und untröstlich macht.
Bergs Körper kann nicht stillhalten, er ist triebhaft, er stampft, schreit und wütet bis er explodiert. Die Figuren des Körpers gehen in die Musik ein, so auch bei Schumann[293] und seiner Kunst der Schläge. In dem Klavierwerk „Kreisleriana", Op. 16 (1838), hört Marcel Beaufils das im Körper Schlagende, das den Körper Schla gende oder besser: diesen schlagenden Körper. Der stets labile psychische und körperliche Zustand Robert Schumanns nimmt im Tagebuch breiten Raum ein. Beständiges Singen und Brausen registriert der Empfindsame. Was wir im V. Satz der „Lyrischen Suite" wahrnehmen, ist das Gewimmel der Schläge, dringt doch die Musik weiter vor bis ans Ohr: sie dringt durch die Schläge ihres Rhythmus in den Leib, in die Eingeweide. Das Herzschlag - Motiv der Takte 133, 142, 145, 183, 189 und 201 rahmt Berg mit roten Klammern. Auf zwei komplizenhaften Wegen haben sich das Begehren und der Taumel vermengt: ,,Ein in stetem Herzklopfen dahintorkelnder Wahnsinniger"[294] gerät an den Abgrund der Töne.
Die Musik der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts endete im reinen, absoluten Klang Körper, bereits Herder und Hegel formulierten die Klangästhethik zu dieser Absolu tion.[295]Die Musik der 2. Wiener Schule - Schönberg, Berg, Webern - wird den radikal neu-konstruierten Tonraum nach und nach ins Geräusch, ins Verstummen drängen; so schreibt Adorno über Weberns Musik, sie sei „die Nachahmung des Geräusches eines Körperlosen."[296] Das Geräusch verhält sich zur Musik wie die Schale zum Weichtier. Siegfried Kracauer hat in einer Reihe von Filmkritiken so etwas wie die filmische Phä nomenologie des Geräusches umkreist. Der legendäre Aufsatz „Tonbildfilm"[297] (1928) endet mit der Passage: ,,Zu seinem eigentlichen Sinn wird der Tonfilm erst gelangen, wenn er das vor ihm nicht gekannte Dasein erschließt, das Tönen und lärmen um uns, das mit den Bildeinheiten noch niemals kommunizierte und stets den Sinnen entging." Eric Satie, Luc Ferrari[298] und John Cage haben den Absprung zu den Erscheinungen des Zufälligen, Ungeformten vollzogen. In dem berühmten „tacet"-Stück „4'33" " lotete John Cage die Geräusche der Stille aus.
Alban Berg hat in der Taschenpartitur im VI. Satz ein Sonett Charles Baudelaires eingeschrieben. Lange, jahrzehntelang wurde nach diesem Gedicht gefahndet, fleißige Detektivarbeit der amerikanischen Musikwissenschaft[299] hat dieses endlich im Jahre 1976 zu Tage gefördert und als Vokaltakte enttarnt - der VI. Satz, Largo desolato, kann nunmehr als textgebundene Musik gelten. In der Widmungspartitur glitzert wie ein Rubin in Takt 12 das mit roter Tinte eingeschriebene Poem „De profundis clamavi" aus Baudelaires Gedichtband „Les Fleurs du Mal".
Bergs Hand, die Töne und Wörter aufs Papier kritzelt, die weder komponieren kann ohne zu schreiben, noch schreiben ohne zu komponieren, die jedoch auch weder Töne noch Wörter schreiben kann, ohne nicht auch zu singen, diese Hand bedarf der Ergänzung, die die Stimme gibt. Das in das Streichquartett eingeflochtene Poem Baudelaires bedarf des Durchgangs durch die Stimme. Das Ich, das um seine zunichte gewordenen Liebeshoffnungen trauert, kann nur noch singen.
Man erinnert sich an die schöne Zeile Goethes: ,,So fallen meine Lieder/gehäuft in deinen Schoß."[300] „Die Menge der Wörter ist begrenzt, die der Akzente unendlich" schreibt Denis Diderot 1767 im „Salon" und weiter lesen wir: ,,Die Intonation, das ist das von dem Tonfall der Stimme wiedergegebene Bild der Seele". Und der Tonfall der Stimme ist „wie ein Regenbogen".[301] Stimme ist Diffusion, sie geht durch das Ohr und auch durch die Haut. Berg hat an der Vokalpassage des VI. Satzes wie an einem Edelstein gearbeitet. Notenhälse, Fähnchen und Querbalken des Notenberges sind in der Widmungspartitur schwelgerisch in rote Tinte getaucht. Es ist als schufte Berg an diesen Vokaltakten 12, 16, 20, 25, 28, 30, 34 und 40 wie ein Bildhauer, der sein Inneres freizu hauen, freizulegen angetreten ist:
,,Zu Dir, Du einzig Teure, dringt mein Schrei,
Aus tiefster Schlucht, darin mein Herz gefallen.
Dort
ist die Gegend tot, die Luft wie Blei
Und in dem Finstern Fluch und Schrecken wallen (... )"[302]
Das Gedicht - das ganz einer augustinischen[303] Stimmung der poetischen Selbstaus löschung folgt, läßt das Vernunftland der reinen Töne endgültig ins Wanken geraten. In Takt 26/27 nimmt Berg schließlich Anfang und Ende des Tristan-Motivs ins Visier. Von dort führt kein Pfad mehr zur Welt zurück. Die Liebe Tristans zu lsolde findet nur im Tode ihre Erfüllung. Ihr Mythos ist, wie Denis de Rougemont in seiner Studie über „L'amour et l'occident" (1939) zeigt, die ausführlichste Darstellung mittelalterlicher manichäischer Liebesvorstellung, nach der Liebe als Leidenschaft Liebe ist, die den Tod will.[304] In den letzten Takten der Quartettsuite verstummen die Geigen und das Violon cello. Der Schlußtakt (46 = ,,[2] x 23 Takte") gehört allein der Bratsche. Mit grüner Tinte schließt Berg seine Gabe an Hanna: ,,ersterbend in Liebe, Sehnsucht und Trauer", lautet die lakonische Eintragung auf der letzten Seite der Widmungspartitur.
Nach 83 Seiten sitzt man wie versteinert da. Reaktionen der Körperhaut sind die Folge: genauso wie bei der Motette Claudia Monteverdis „Ego dormio",[305] die in einem Film von Robert Bresson[306] eingespielt wird. Bressons Kinematographenkunst hat Ähnlichkeit mit der Tonkunst Alban Bergs. Beide Künstler teilen die Stille, das Bruchstück- und Balla denhafte. Berg schreibt „Wozzeck" als Passionsspiel und Bresson lässt die Leidensge schichte des Bauermädchens „Mouchette" (1967) auf der Leinwand in Schwarzweiß vorüberziehen, und er erzählt in „Au hasard, Balthazar" (,,Zum Beispiel Balthasar", 1966) die Geschichte eines Esels, dessen Kindheit, Jugend, Leiden und Tod. Balthasar verblutet an einer Schußwunde, die Kamera filmt das niedergesunkene Tier und dessen brechendes Auge. Der lautlose Todeskampf der Kreatur wird nur vom Gebimmel der Schafe und Klaviermusik von Schubert begleitet. Wozzeck, der Wehrlose blutet an seiner Liebe zu Marie aus. Sein Selbstmord vollzieht sich stumm im Schilfteich, begleitet von Unkenrufen.[307] Berg setzt Flöte, Klarinette und Horn im III. Akt, 4. Szene, Takt 302 ein. Man denkt an die Zeile Rilkes „Siehe, deine Seele verfing sich in den Stäben der Syrinx."[308]
Alban Berg, eine an Neuromantik und Ästhetizismus orientierte Existenz, war ein glühender Verehrer der poetes maudits, die sich mit Charles Baudelaire die „wunderbare Macht" teilen, „mit einer eigenartigen Gesundheit des Ausdrucks jeden flüchtigen, jeden verschwommenen morbiden Zustand erschöpfter Geister und trauriger Seelen festzuhalten".[309] Es läßt sich am schrittweisen, zögernden und langsamen Arbeits prozeß der letzten Jahre nachvollziehen wie überzeugend Alban Berg einzelne Gedichte Baudelaires in die eigene Tonsprache übersetzte und wie er sensibel atmosphärische Schwingungen der Modeme registrierte.
Alban Bergs Auge war vollgesogen mit Versen Baudelaires, deren unverwandter, kalter Glanz alle Unreinheit[310] zerstrahlt. Berg muß die Existentialpoetik des französischen Lyrikers (1821-1867) fasziniert haben wie die zahlreichen Anstreichungen und Markierungen in Baudelaire-Bänden seiner Hausbibliothek[311] belegen.
Baudelaire, der dichtende Dandy wanderte unzählige Stunden nächtens in Ruinen Paris des Second Empire[312] umher, streunende Katzen und Huren[313] als Gefährtinnen der Einsamkeit; geneigt dem Müßiggang, dem Spiel und der Prostitution, tastend nach einer Utopie der Schönheit, des Luxus und der Wollust.[314]
Der Dichter hatte einen ausgeprägten Geschmack am Artifiziellen, das Haar trug er grün, was ihn zu einem Vorläufer von Des Esseintes macht, dem hypersensiblen Ästheten in Joris-Karl Huysmans Roman „A rebours"[315] (,,Gegen den Strich"). Baudelaires Text „Lob der Schminke"[316] macht dies deutlich: ,,M. Baudelaire ist künstlich in allem. Er pudert sich, sagen seine nächsten Freunde, und er schminkt sich sogar."[317]
Fünfzehn Jahre lang arbeitete Baudelaire an den „Fleurs du Mal",[318] die zunächst „Les Lesbiennes" (1845) und später „Les Limbes" (1848, ,,Die Vorhölle") heißen sollten. Vom Februar bis Juni des Jahres 1857 korrigierte er die Druckfahnen des 248 Seiten umfas senden Manuskriptes der „Fleurs du Mal", dessen Buchtitel der Kritiker und Romancier Hippolyte Babou gefunden hatte. Wie Balzac und Proust behandelte er die Druckfahnen als eine Art von gedrucktem Manuskript. Kurz bevor er die „Blumen des Bösen" für druckfertig erklärte, antwortet er seinem Verleger und Freund Poulet-Malassis, der ihn drängt, im Mai 1857: ,,Ich kämpfe mit etwa dreißig ungenügenden, unerfreulichen, schlechten und schlecht gereimten Verszeilen."[319] Seine Hauptsorge war, daß der Band zu schmal und unscheinbar aussehen könnte. Baudelaire ließ dem Dichtwerk eine exquisite Ausstattung angedeihen und am 13. Juni 1857 wird er Rezensions- und Widmungsexemplare[320] zu verschicken beginnen. Vier Gedichte der „Fleurs du Mal" ,,Le Reniement de saint Pierre" (,,Die Verleugnung des heiligen Petrus"), ,,Lesbos" und die zwei Gedichte mit dem Titel „Femmes damnees" (,,Verdammte Frauen") werden alsbald die Aufmerksamkeit der Justiz auf sich ziehen und es ist sehr wahrscheinlich, daß der „Figaro" für den Prozeß gegen den Autor der „Fleurs du Mal" mitverantwortlich war.[321]
Claude Pichois und Jean Ziegler erinnern daran, dass die Ausgabe der ,Fleurs du Mal' von 1861 (Auflage 1500 Stück) fast mit demselben Recht als Originalausgabe zu bezeichnen ist, ,,wie die von 1857. Sie enthält nicht nur ein Drittel mehr Gedichte, sondern die Gedichte sind auch in einer anderen Reihenfolge angeordnet, was nicht ohne Einfluß auf ihre Bedeutung ist. Außerdem fügte Baudelaire den ursprünglichen fünf Abschnitten - ,,Spleen et Ideal", ,,Fleurs du Mal", ,,Revolte", ,,Le Vin", ,,La Mort" (auch diese in anderer Reihenfolge) - einen sechsten hinzu: ,,Tableaux parisiennes" (,,Pariser Bilder"). Das Buch endet mit dem langen Gedicht „Le Voyage" (,,Die Reise")." ,,Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich fast zufrieden", schreibt der Dichter am 1. Januar 1861 an seine Mutter, Madame Aupick, ,,das Buch ist beinahe, wohl geraten und es wird bleiben, dieses Buch als Zeugnis meines Ekels und meines Hasses auf alle Dinge."[322]
Nachdem Baudelaire die letzten großen Gedichte der „Fleurs du Mal" geschrieben hatte, konstruierte er eine „poetische Prosa, musikalisch, aber ohne Rhythmus oder Reim, biegsam und kontrastreich genug, um sie den lyrischen Bewegungen der Seele anzupassen, den Wellenlinien der Träumerei, den Erschütterungen des Bewusstseins. Vor allem der Aufenthalt in den riesigen Weltstädten, wo unzählige Beziehungen sich kreuzen, läßt dieses quälende Ideal entstehen".[323] Baudelaire, ein Zeitgenosse des frühen Hochkapitalismus führte die Figur der sexuellen Begierde, die ihre Objekte in der Straße sucht, in die Lyrik ein, ,,Das Kennzeichnendste aber ist," bemerkte Walter Benjamin,[324] daß Baudelaire „das mit der Zeile, ,crispe comme un extravagant' in einem seiner vollkommensten Liebesgedichte tut: ,A une passante':"
Einer Dame
Geheul der Straße dröhnte rings im Raum.
Hoch schlank tiefschwarz, in ungemeinem
Leide
Schritt eine Frau vorbei, die Hand am Kleide
Hob majestätisch den gerafften Saum;
Gemessen
und belebt, ihr Knie gegossen.
Und ich verfiel in Krampf und Siechtum an
Dies Aug' den fahlen Himmel
vorm Orkan
Und habe Lust zum Tode dran genossen.
Ein Blitz, dann Nacht! Die Flüchtige, nicht leiht
Sie sich dem Werdenden an ihrem Schimmer.
Seh ich
dich nur noch in der Ewigkeit?
Weit fort von hier! zu spät! vielleicht auch nimmer?
Verborgen dir mein Weg und mir wohin du mußt
O
du die mir bestimmt, o du die es gewußt![325]
Baudelaire macht im Sonett „A une passante (XCIII)" einen Verrückten (,,crispe comme un extravagant", Vers 6) und eine Prostituierte (,,souslevant, balancant le feston et l'ourlet", Vers 4) zu Aktanten der Begegnung: ,,Ich sog, wie ein Verstörter hingebogen, aus ihres Auges Himmel, drin Gewitter zogen, Süsse, die fasziniert, und Lust, die tötet ein."[326]
Baudelaire streut die Saat einer neuen Liebeswelt. Aus den Lesbierinnen-Gedichten in den „Fleurs du Mal" darf geschlossen werden, dass diese als radikale erotische Bourgeoisiekritik gedacht waren - die „Leichenbitter der Liebe"[327] werden auch ein Gegenstand des Spottes, der Satire und Karikatur in den Bildwerken Honore Daumiers und Jean lsidore Grandvilles werden. Eine Wahlverwandtschaft zu den erotischen Wunschträumen des Charles Baudelaire zeigen auch die Gemälde Gustave Courbets. Immer wieder begegnen wir weiblichen Körpern, die von Liebesraserei erschlafft, in sanften Schlummer fallen. 1866 setzt Gustave Courbet ein Liebeslager lesbischer Frauen in subtilster Weise ins Bild. Courbets Pinsel handelt hier nicht nach Gesetzen der bürgerlichen Moral, sondern nach dem Wollustrausch der galanten Zeit: Perlen, Düftekissen, Seide, Blumenbund, Vase, Karaffe und Kristallglas schmücken das Boudoir. ,,Der Schlaf" (,,Le sommeil", 1866), ein Bild von kristalliner Schönheit, ist in die Kunst- und Skandalgeschichte des 19. Jahrhunderts eingegangen.[328]
In Baudelaires Sonette CXI „Femmes damnees", ,,Delphine et Hippolyte", sagt die Leh rerin der lesbischen[329] Liebe zu ihrer unerfahrenen Freundin:
„Meine Küsse sind leicht wie jene Eintagsfliegen, deren Abendtanz die großen, bis in die Tiefe klaren Seen liebkosend streift, und die deines Geliebten werden ihre Furchen ziehn wie Ackerkarren oder scharfe Pflugschar. [Vers 29-34]
Geh, wenn du magst, und suche dir einen albernen Verlobten; lauf, und biete seinen grausamen Küssen ein jungfräuliches Herz; voll Reue und Entsetzen, fahlen Ange sichts, wirst du mir wiederkehren und gezeichnet deine Brüste weisen". [Vers 69-72][330]
Die Subversion von Baudelaires (ungeheuren) Gedichten der Liebe insistiert bis heute. Die Liebe „aller Himmelsstriche" in allen ihren Formen kehrt in Baudelaires Traum einesMuseums der Liebewieder, alle erotischen Potentiale ziehen da vorüber: von der unausgesprochenen Zärtlichkeit der heiligen Therese bis zu den großen Wahrheiten der ausschweifenden Liebe: ,,Ist es euch wohl schon ergangen wie mir, daß ihr in großer Melancholie verfallen seid, nachdem ihr Stunden damit verbracht habt, in ausschweifenden Kupferstichen zu blättern? Habt ihr euch danach gefragt, warum ein derartiger Reiz darin liegen kann, in diesen Jahrbüchern der Wollust zu wühlen, die in Bibliotheken vergraben oder in Kisten von Trödlern verloren sind, und manchmal auch nach der schlechten Laune, die sie euch verursachen? Lust vermischt mit Schmerz, Bitterkeit, nach der die Lippen immer dürsten! - Die Lust liegt darin, das wichtigste Gefühl der Natur unter allen seinen Formen dargestellt zu sehen, und der Zorn, es häufig so schlecht imitiert oder so dumm verleugnet zu finden. An endlosen Winter abenden beim Schein des Feuers, im dumpfen Müßiggang der Hundstage oder an der Ecke der Glaserbudiken, immer hat mich der Anblick dieser Zeichnungen in ein Gefälle unermeßlicher Träumerei versetzt - etwa so, wie uns ein obszönes Buch in die geheimnisvoll blauenden Meere stürzt. Vor diesen unzähligen Gefühlsproben jedes einzelnen habe ich oft empfunden, daß sich der Dichter, der Kunstfreund oder der Philosoph den Genuß eines Liebesmuseums schenken sollten, in dem alles seinen Platz hätte, von der unausgesprochenen Zärtlichkeit der heiligen Therese bis zu den mit Bedacht betriebenen Ausschweifungen der übersättigten Jahrhunderte. (... )
Der Moralist möge sich nicht gar zu sehr entsetzen; ich weiß das richtige Maß zu halten, und mein Traum würde sich übrigens darauf beschränken, dieses gewaltige Gedicht der Liebe nur von den reinsten Händen ausgeführt zu wünschen, von lngres, von Watteau, von Rubens und Delacroix! Die mutwilligen und eleganten Prinzessinnen von Watteau neben der nachdenklichen und ruhigen Venus von lngres; die köstlich weißen Leiber von Rubens und Jordaens und die düsteren Schönheiten von Delacroix, wie man sie sich vorstellen mag: große, bleiche Frauen, ertränkt in Satin!
Um die aufgeschreckte Keuschheit des Lesers ebenfalls vollständig zu beruhigen, füge ich hinzu, daß ich nicht nur alle Bilder, die in Sonderheit die Liebe behandeln, in das Liebes-Thema aufnehmen würde, sondern auch alle Bilder, die Liebe atmen, und mag es ein Porträt sein.
In dieser riesigen Ausstellung stelle ich mir die Schönheit und die Liebe aller Himmelsstriche von ersten Künstlern ausgedrückt vor, von den närrischen, flatterhaften und herrlichen Geschöpfen, die Watteau uns in seinen Modestichen hinterlassen hat, bis zu jenen Aphroditen des Rembrandt, die sich wie gewöhnliche Sterbliche die Nägel schnei den und mit groben Buchsbaumkamm sich kämmen lassen.
Die Dinge dieser Natur sind dermaßen wichtig, daß es keinen Künstler, groß oder klein, gibt, von Giulio Romano bis zu Deveria und Gavarni, der sich nicht heimlich oder öffentlich um sie bemüht hätte.
Ihr großer Fehler besteht im Allgemeinen darin, daß es ihnen an Naivität und Aufrichtigkeit fehlt. Ich erinnere jedoch eine Lithographie, die leider ohne allzuviel Feinheit - einer der großen Wahrheiten der ausschweifenden Liebe ausdrückt. Ein junger, als Frau verkleideter Mann und seine als Mann angezogene Geliebte sitzen Seite an Seite auf einem Sofa - dem wohlbekannten Sofa des Hotel Garni und des Cabinett particulier. Die junge Frau will die Röcke ihres Geliebten hochheben. - Diesem wollüstigen Blatte würden in dem idealen Museum, von dem ich sprach, manche anderen gegenüberstehen, auf denen die Liebe nur in der zartsinnigsten Form erschiene.
Zu diesen Betrachtungen regten mich neuerdings zwei Bilder von Tassaert an: ,Erigone' und ,Der Sklavenhändler'. Tassaert ist ein Maler von großem Verdienst, dessen Talent sich aufs glücklichste für die amoureusen Stoffe eignen würde. (... )"[331]
Eine Symmetrie zu Baudelaires dionysischem Lusttempel bilden die Musik-Formeln Alban Bergs. Baudelaires „Erotologie des Verdammten"[332] ist eingekapselt in „Wozzeck", ,,Lulu" und nicht minder in der „Lyrischen Suite". In Baudelaires „Wein-Zyklus"[333] (1850- 1857) wird Berg die Seufzer und Sehnsüchte der „schmächtigen Athleten des Lebens"[334] aufspüren. Die aus dem „Wein-Zyklus" ausgewählten Gedichte „Die Seele des Weines", ,,Der Wein der Liebenden" und „Der Wein des Einsamen" mutieren in der Konzertarie „Der Wein"[335] (1929) zur Zwölfton-Poesie. ,,Man muß immer trunken sein," ruft Baudelaire emphatisch aus, ,,berauscht euch, berauscht euch ohne Unterlass! An Wein, an Poesie, an Tugend, ganz nach Geschmack!"[336]
Eingesponnen in die Quadratur des Kreises, ausgesetzt dem Liebes-Weh schreibt Berg an Hanna am 4. Dezember 1929: ,,Und auch, wenn ich - wie heuer im Sommer - den Wein besang: Wen anders geht es an als Dich, Hanna, wenn ich (im ,Wein der Lieben den') sage: ,Lass Schwester uns Brust an Brust fliehn ohne Rast und Stand In meiner Träume Land' ... und diese Worte im leisesten Zusammenklang von H-und F-Dur verklingen! - - Was dann folgt, kann ja nur noch das Lied sein vom Wein des - Einsamen. Ja der bin ich und bleib ich, aber auch als der: ganz und ewig Dein."[337]
Berg, der exemplarische Zweifler an Sprache, brütet über der Baudelaire-Übertragung Stefan Georges, an Soma Morgenstern schreibt er am 12. Juni 1929 über die „Wein Gedichte": ,,Mein lieber Soma, ich komme mit einer großen Bitte an Dich: ich bin eben beim Komponieren der Wein-Gedichte von Baudelaire-George. Und da kommen mir einige Stellen sprachlich ganz rätselhaft vor. Ich habe die Gedichte abgetippt und alles, was mir - besonders die Synthax betreffend- nicht geheuer vorkommt, mitrotemBleistift angezeichnet. Ich bitte Dich nun die Lösungen daneben hinzuschreiben; vielleicht in der Art, daß Du in Frage kommende Stellen in Prosa übersetzest, oder zumindestens durch Interpunktionen andeutest, ob das als Satz oder als Nebensatz oder nur als Ausruf zu verstehen ist?!"[338]
Als Soma Morgenstern nicht rasch genug die Korrekturen übermittelt, wird auch Otto Jokl, ein Schüler Bergs, der schon zu zahlreichen Korrekturarbeiten an der „Lyrischen Suite" herangezogen wurde, mit der George Übersetzung konfrontiert. Der eifrig ergebene Jokl sucht in der „Zentralbibliothek" Wiens nach einer französischen Ausgabe der „Fleurs du Mal", macht Abschriften der Verse, stellt Vergleiche an und am 21. August 1928 antwortet er Alban Berg. ,,George hat die Gedichte, soweit ich mit meinem armseligen Französisch urteilen kann - wirklich - u[nd] zw[ar] herrlich!! - umgedichtet! Wegen der Notizen Herrn Bergs am Rand der Blätter wage ich nicht, die Gedichte länger zu behalten, gestehe aber, dass ich sie mir (samt Notizen) abgeschrieben habe."[339] Nachdem Berg auch die Stellungnahme Morgensterns erhalten hat, erwidert er dem Freund am 6. August 1929: ,,Mein lieber Soma, mein langes Schweigen soll natürlich keine Revanche dafür sein, dass Du meine dringende Anfrage die Baudelaire-Texte betreffend, fast 5 Wochen unbeantwortet ließest. So lange, bis ich mit der Komposition fast fertig war (... ) Wenn ich jetzt mit den Schreibarbeiten an der Arie, mit der ich recht zufrieden bin, fertig bin (Partitur, Reinschrift, Klavierausdruck etc.) (... ) so plane ich endlich wieder an die ,Lulu' zu gehen."[340]
Alban Berg näherte sich dem „Wein-Zyklus", da dieser die Schnittstelle zwischen imaginären und realen Welten zu artikulieren vermag und die zur Verzweiflung Ver dammten in „holdem Rausche schwelgend"[341] elliptisch aneinanderreiht: Den Lumpen sammler,[342] den Mörder, den Spieler, die Freudenmädchen, die Liebenden und: den frommen Dichter. Baudelaire schrieb ein Requiem für all die „Verdammten, die schwei gend sterben"[343] und Berg gelingt eine musikalische Parallelschöpfung - ,,Musik, dem fernen Klagelaut menschlichen Schmerzes gleich".[344] Mit der Komposition „Der Wein" für Sopranstimme und Orchester, in „herzlichster Ergebenheit" der Sängerin Ruzena Herlinger[345] gewidmet, begann Alban Berg Ende Mai 1929 in Trahütten und er voll endete die Partitur am 23. August. Angelegt ist die Arie wie ein dreiflügeliger Altar - unter eine streicher- und bläserdominante Klangaura mischte Berg Tango-Bruchstücke. Der Griff des Weißen in die Musik der Schwarzen dauerte an der Jazz[346] wird in der Oper „Lulu" wiederkehren.
Berg steht Baudelaires Dolorismus ganz nahe: ,,Im Seelischen wie im Körperlichen habe ich immer die Empfindung des Abgrundes gehabt, nicht allein des Abgrundes des Schlafes, sondern auch des Abgrundes der Tätigkeit, des Traumes, der Erinnerung, der Begierde, des Bedauerns, der Reue, des Schönen, der Zahl u.s.w."[347] Das Quälerische und zugleich Genussreiche dieses Eindringens in den Abgrund des Bewußtseins, das erst in der poetischen Gestalt der Musik zu seiner Klärung und Ablösung von seiner Unmittelbarkeit der Subjektivität kommt, fand seine geniale musikalische Ausdrücklichkeit in der Komposition der „Lyrischen Suite". Durch die Verflechtung der Themen Liebe und Entsagung, durch ihr so besonderes Skandieren, durch diese Folge von Kontra punkten, die ineinander gleiten wie aufeinanderfolgende Wellen, schenkt Berg der Kammermusik des 20. Jahrhunderts neue Ausdrucksmöglichkeiten. Die Lyrische Suite entspringt dem Augenblick einer schmerzlichen Bilanz, in der die umworbene Geliebte sich dem, der seine Lebenszeit in vergeblichem Liebesbegehren aufgezehrt hat, schon in eine unerreichbare Ferne entzogen hat.
Mitte der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts geriet Alban Berg in eine bedrohliche Isola tion, sowohl musikalisch durch das Vordringen des Nationalsozialismus[348] in Österreich, der das Musikschaffen der 2. Wiener Schule radikal ausgrenzte, wie existentiell - die wachsenden finanziellen Sorgen engten die bürgerliche Existenz[349] beträchtlich ein.
In einem tristen Dämmerzustand hat Alban Berg die letzten Jahre verbracht, eigentlich nur gespürt wie die Stunden vergehen. Sein Waldhaus[350] in Auen am Wörthersee steht inmitten einer Wildnis, ein Haus von dem es heißen könnte, daß es das letzte aller Häuser ist, in das sich Berg eingeschlossen[351] hat. Aus einem rechteckigen Fenster stürzt das Mittagslicht auf den Arbeitstisch nieder, Notenhaufen schwimmen im Netz, draußen verströmen Erdbeeren ihren süßen Duft, Löwenzahn steht vor der Tür. Im Herbst bildet sich Dampf auf den Glasscheiben, darauf man mit dem Finger schreiben kann. Wein überflutet den Zurückgelassenen.
Bergs höchste ästhetische Aufmerksamkeit gilt im Jahre 1934 der Fertigstellung der „Lulu"-Partitur. ,,Der See, obwohl eislos, in Todesstille verharrend",[352] umgibt ihn am Karfreitag des Jahres 1934. In all den Monaten gerät sein Blick an die geliebten Pflanzen: Da sind die Blüten der Kirschbäume, die Alpenrosen, der hochstielige Enzian unter den Fichten, die Zyklamen und das Edelweiß: ,,Alles, alles in Blüte," schreibt er am 10.7.1934 an Anton Webern, ,,aber fast hab' ich nichts von all der Pracht: ich komm ja nicht weg vom Schreibtisch u. fühle mich gehetzt wie noch nie im Leben. Vielleicht hab ich im August etwas mehr Ruhe: für mich u. meine Arbeit: die Part. der Oper, die ich dann von vorne beginnen werde".[353] Er sitzt am Schreibtisch, man riecht den Zigaretten rauch im Zimmer, in der Hand hält er den Füllhalter Hannas wie ein Schutzschild.
Seitdem Hermann Broch im Jahre 1930/32 mit der Veröffentlichung der „Schlafwandler Trilogie"[354] auf sich als Romancier aufmerksam machte, wird Berg von dem Werk des Freundes angezogen und angeregt werden. Ohne die Erlebnisse und Reflexionen während der Beziehung Brochs zu Ea von Allesch ist die „Schlafwandler-Trilogie" nicht denkbar. Das Erlebnis des mehrjährigen Zusammenseins mit Ea bedeutet eine Lebenswende für Hermann Broch: ,,Das Teesdorfer Tagebuch für Ea von Allesch"[355]wird von Mitte 1920 bis Anfang 1921 geschrieben und in der Figur von Hanna Wendling setzte der Dichter in der „Schlafwandler-Trilogie" der Geliebten ein literarisches Denkmal. Ea war ihm „das lichte Glück", die erste Frau, die er als „absolut heimatlich, nah, unentbehrlich, einzig" empfand; drohe eine Trennung, käme das dem „kompletten Zusammenbruch des ,Ichs' gleich".[356] Am 15.4.1929 wird Hermann Broch den letzten Abend in Ea's Wohnung verbringen und bis zur Emigration im Jahre 1938 nur in loser Verbindung mit Ea verbleiben. Im Sommer 1951 will Broch Ea von Allesch in Wien wieder sehen, der Dichter erliegt jedoch am 30. Mai jenes Jahres in seinem amerikanischen Domizil in New Haven, Connecticut einem Herzschlag.[357] 1958 starb Ea im Alter von 78 Jahren in Wien im Krankenhaus Lainz.
Als Emma Elisabeth Täubele wurde sie am 11. Mai 1875 in Ottakring als 9. von 12 Kindern einer Arbeiterfamilie geboren. Durch Robert Musil wurde sie mit Johannes von Allesch bekannt, den sie am 28. Februar 1916 heiratete. Seit 1917 traf Broch regelmäßig mit der verheirateten Frau zusammen, zunächst in Wiener Kaffeehäusern, dann in ihrer Wohnung in der Salesianergasse. Peter Altenberg[358] legte sich eine Sammlung von Ea-Photos an, die er mit Epigrammen versah; bewundert wurde sie von Egon Friedell, Alfred Polgar,[359] Rainer Maria Rilke und von den Malern Anton Faistauer, Franz Blei und Oskar Kokoschka. Den Lebensunterhalt verdiente die „Königin des Cafe Central"[360] mit hervorragenden Zeitungsartikeln über Damenmode.[361] Aus ihrem Vornamen Emma eliminierte sie die beiden mittleren Buchstaben.
Mit ihren roten Haaren, den hohen Wangenknochen und den grau-grünen Augen weckte Ea von Allesch „Lulu" Assoziationen. ,,Wie Diana,[362] jungfräulich und kühl, schritt sie durch die Reihen ihrer Bewunderer", notierte Helga Malmberg in ihren Memoiren.[363] Für die männlichen Trieb-, Aggressions- und Angstphantasien des Fin de Siècle war Ea eine willkommene Projektionsfigur, denn an ihr konnte sich die Vorstellung der femme fatale[364] bzw. femme fragile entzünden. Gustav Klimt, ein Freund Alban Bergs, hat sich der Exzentrizität der Kind-Frau in „Wasserschlangen 11" (,,Freundinnen")[365] 1904/07 genähert und jeden morphologischen Zug Ea's ins Androgyne getrieben - auf der Leinwand schlängelt sich eine mit Anemonen (Klimts Lieblingsblumen) geschmückte, nackte Nymphe, der man in den „Metamorphosen" Ovids immer auf der Spur ist, ohne sie je zu erreichen.
Da ist Apollons Verfolgung der Nymphe Daphne durch dorniges Gelände in Erinnerung zu rufen: ,,Nymphe, bleib stehn! So flieht das Lamm vor dem Wolf, die Hirschkuh vor dem Löwen, so fliehen vor dem Adler die Tauben mit ängstlich schlagenden Flügeln - ein jedes vor seinem Feind; Liebe ist der Grund, warumichdich verfolge. Weh mir! Stürz nicht vorn über und lass die Dornen nicht deine Schenkel ritzen, die keine Verwundung verdienen. Ich will dir keinen Schmerz zufügen. Die Gegend, durch die du dahineilst, ist rauh. Lauf bitte langsamer und zügle deine Flucht! Auch ich will dich langsamer verfolgen."[366] Ovid umkreist und streift das Fliehende. Ovids Liebeskunst gilt mehr dem Verfolgen, nicht dem Erreichen, denn die Berührung würde das Liebesobjekt in einen Vogel oder eine Blume verwandeln und den Traum verscheuchen.
Ein unwiderstehliches Durchforsten der Lüste oder wie Pascal sagte, ,,die Bindung an vergängliche Geschöpfe", zelebrierte auch Frank Wedekind. Seine ars erotica hat narzißtische, masochistische und sadomasochistische Phantasien massiv freigesetzt und die Erregung der hohen, aufgepeitschten, emporgewachsenen lesbischen Empfin dung auf der muschelförmigen Bühne des Fin de Siècle ausgebreitet. ,,Erdgeist" ist der erste Teil der sogenannten „Lulu"-Tragödie, deren Fortsetzung und Schluß unter dem Titel „Die Büchse der Pandora" 1904 uraufgeführt wurde.[367]
Der ephebenhafte Jüngling Alban Berg - der aussah „wie ein Engel"[368] - und der Buddha und blauen Elefanten nachsinnte, wird den Einführungsvortrag von Karl Kraus anläßlich der Wiener Aufführung von Wedekinds „Büchse der Pandora" am 29. Mai 1905 im Trianon-Theater aufmerksam verfolgen und im Jahre 1928 wird er sein „Lulu"-Libretto[369] mit Hannas goldener Füllfeder zu schreiben beginnen. Bergs furiose Akribie, sein leidenschaftliches Bestreben stets das Äußerste an Ausdrucksdichte zu erreichen verlangte einen Balanceakt, der zwischen Buch und musikalischen Proportionen zu leisten war. Immer wieder hält er inne, Lust und Depressionen wechseln einander ab, nach fünf Jahren Schreibkrämpfen stehen im „Lulu"-Torso Kristallisiertes und Faseriges dicht nebeneinander.
Ein letztes Schreibglück sollte Alban Berg im Jahre 1935 noch beschieden sein. Das von Louis Krasner in Auftrag gegebene „Violinkonzert"[370] wurde von Berg nach zwei monatiger Arbeit mit Hast und Erschöpfung am 15. Juli 1935 beendigt: ,,Ich hatte nämlich an diesem Tage die Komposition des ,Violinkonzertes' soviel wie beendet und saß von sieben Uhr früh bis neun Uhr abends fast ununterbrochen am Klavier und Schreibtisch. Und dann war ich nach einem fast dreizehnstündigen Arbeitstag so todmüd, daß ich unfähig war, noch Musik aufzunehmen u. schlafen ging."[371] Fern gerückt den schillernden Farbnotationen früherer Kompositionen, ist das Particell des „Violinkonzertes" in stumpfem Bleistift-Schwarz ausgeführt. Im Bleistift-Gebiet ist oft radiert, manches verschmiert, manchmal mischt sich blauer Bleistift unter das Grau. Seismographisch zeichnet Berg die feinsten Erschütterungen einer Künstlerexistenz nach. Das Musikstück ist Manon Gropius,[372] der 19-jährigen Tochter Alma Mahler Werfels gewidmet, die am Ostermontag des Jahres 1935 an Kinderlähmung verstarb. Nicht nur Einflüsse von Gustav Mahler,[373] Richard Strauss und Johannes Brahms, auch alles Konstruktivistische, das hinter dem Stück stehen mag, werden hinweggeschwemmt von der somnambulen Klangsinnlichkeit, in der splittrig Folkloristisches und Chorallied-Zitate zittern. Berg deutet ohne jeden Trost auf die Endlichkeit des Lebens. Buchsbaumfarben endet das Musikstück. Am Schluß des zweisätzigen Violinkonzertes steht der Ton H und die der Komposition zugrundeliegende Reihe weist ebenso in der Wahl der Begrenzungstöne auf H und F[374],die Initialen von Hanna Fuchs. Er wird die Abwesende weiter schweigend begehren und die Begierde wird sie aus der Ferne umhüllen, ohne sie anzutasten, ohne daß sie dessen überhaupt gewahr wird. Liest man den letzten Brief vom Winter des Jahres 1934 an Hanna, so wird der Tonfall an den Kreuzweg des Begehrens in Stefan Zweigs[375] Novelle „Brief einer Unbekannten" erinnern: Hier schreibt die todgeweihte, hoffnungslos Liebende: ,,Keine Zeile habe ich von Dir in meinen letzten Stunden, keine Zeile von Dir, dem ich mein Leben gegeben. Ich habe gewartet, ich habe gewartet wie eine Verzweifelte. Aber Du hast mich nicht gerufen, keine Zeile hast Du mir geschrieben ... keine Zeile (... ) Mein Kind ist gestorben, unser Kind- jetzt habe ich niemanden mehr in der Welt, ihn zu lieben, als Dich. Aber wer bist Du mir, Du der Du mich niemals erkennst, der an mir vorübergeht wie an einem Wasser, der auf mich tritt wie auf einen Stein, der immer geht und weiter geht und mich läßt in ewigem Warten?(... ) Warum soll ich nicht gerne sterben, da ich Dir tot bin, warum nicht weitergehen, da Du von mir gegangen bist?" Von der Erzählung Stefan Zweigs inspiriert, drehte Max Ophüls in Amerika im Mai und Juni 1948 in 42 Tagen „Letter from an Unknown Woman".[376] Der Exilierte lotet in den Studios Hollywoods das Wien um 1900 aus, und er bedient sich der hochwertigen Technik so, ,,daß sie allein dem Ausdruck dient, transparent wird und jenseits der Reproduktion der Realität ein Instrument des Gedankens, des Spiels, der Zauberei und des Traums wird."[377] Mit Hilfe des Produzenten John Houseman, des Drehbuchautors Howard Koch und des Kameramannes Franz Planer gelingt Ophüls ein Film, der zwischen „Liebelei" (1932), ,,Der Reigen" (1950) und „Lola Montes" (1955) pendelt. Die Dekors von Russel A. Gausman, Ruby R. Levitt und Charles Barker, die Bauten von Alexander Golitzen und die Kostüme von Travis Benton umspielen subtil die ornamentale[378] Erotik des Fin de Siècle. Das Auge des Betrachters genießt Helle und Dunkelheit, Farbe und Substanz, Form und Stellung, Entfernung und Nähe, Bewegung und Stillstand.
Max Ophüls Adaption der Liebesnovelle Stefan Zweigs gleicht einer ausgezirkelten Tuschzeichnung. Ein Reigen von Dingen und Schauplätzen rhythmisiert die elliptische Filmkonstruktion: Das Klavier Stefans - Tinte und Feder Lisas - die weiße Rose - Zimmer, Treppen, Gassen und Plätze Wiens - der Bahnhof - der verschneite nächtliche Prater mit der kleinen Eisenbahn - das Praterkaffee und die Walzerkapelle - die Oper und die Arien der Zauberflöte - die Kutschenfahrten. Hinter den Kulissen wird die Architektur des Unbewussten spürbar.
Nirgends in Filmen schneit es so dicht und unaufhaltsam wie in Ophüls kinetischen Lichtbildern. Eine Archäologie[379] des Begehrens betreibt der Cineast vorzugsweise im Schnee, gleich Arthur Schnitzler, der unglücklich Liebende dem Schneeflockengestöber aussetzt. Im Einakter „Weihnachtseinkäufe" (1898) begegnet Anatol am Weihnachts abend Gabriele bei eiligen Einkäufen in der Vorstadt: es schneit unaufhörlich. Auf der Bühne gab vor rund 50 Jahren Paula Wessely die Rolle der Gabriele und in ihrem feinziselierten Sprechgesang konnte man auch die Silben wie Schneeflocken fallen hören.
In „Letter from an Unknown Woman" tanzen Lisa (Joan Fontaine) und Stefan (Louis Jourdan) Walzer im Schnee. Da ist anfangs die weiße Rose und das schwindel erregende Begehren und nach Jahren des Liebesleides blicken wir in das leichenblasse Gesicht der an Typhus erkrankten Lisa, die am Tisch sitzt und die letzten Zeilen an Stefan, den Herzensgeliebten richtet: ,,Wenn du diesen Brief liest, bin ich vielleicht schon tot ... " Lisa übergibt die Botschaft ohne Absender an den Diener Stefans, und noch in derselben Nacht stirbt sie. Nachdem Stefan den Brief gelesen hat, erkundigt er sich nach der Unbekannten. Auf ein Blatt Papier schreibt der Diener ihren Namen: Lisa Berndle. Stefan erinnert sich nur mehr vage an diese Frau, die Liebe ist verronnen wie Wasser aus einer umgestoßenen Vase.
An dieser Stelle wird der Film langsamer und weißer. Die allmähliche Entstellung der Wahrnehmung, das Verschwimmen der Orte und das Verschwinden des Körpergefühls fokussiert Max Ophüls, ein Virtuose der gleitenden Übergänge. In einer Rückblende zeigt er die Einritzungen, die die Sprache der Liebe im Körper Stefans hinterlassen hat: Das junge Mädchen Lisa öffnet Stefan die Tür, sie tritt ihm im Schnee entgegen, sie tanzen Walzer, sie ziehen Spuren im Weichen, er schmilzt in ihren Armen. Auf die hellen folgen die eisigen, gefrorenen, die letzten Sequenzen des Filmes. Die Abfahrt Stefans mit der Kutsche zum Duell. Sein Gegner ist Lisas Mann. Weiss[380] in allen Abstufungen durchzieht die Brief-Filmelegie.
Briefe werden geschrieben und empfangen, einen Brief anzunehmen heißt, ihn erwidern zu wollen, oder ihn achtlos beiseite zu legen. Nicht nur Hanna Fuchs hat Alban Berg mit Schrift- und Notenblättern überhäuft, auch Helene, seine Ehefrau, ist immer Adressat unzähliger Briefbotschaften geblieben.
Beim schnellen Durchblättern des Briefbündels fällt der ungezwungene Redestrom ins Auge. Begierig wandelt der Verliebte im Jahre 1907 auf den Spuren der Dichter und Musiker und umkreist mit Vorliebe Werke, die die Macht der Liebe als eine eminente, schrankenlose Naturkraft schildern: ,,Verehrte, teure Helene! (... ) Wir müssen an das Wunder der Liebe wohl zeitlebens glauben, so wie wir an das Wunder des Todes glauben müssen, wenn auch ,das Geheimnis der Liebe größer ist, als das des Todes'. O nein, teuerste Helene, die Liebe kommt nicht nur in Märchen, Dichterwerken oder in der Musik vor - - nein, nein: die Liebe wurzelt im Leben, und daraus haben es die Dichter geschöpft. Goethe hat bis in sein spätestes Greißenalter mit jugendlicher Inbrunst geliebt, und so konnte er jene herrliche Reihe von Liebeswerken, von ,Werthers Leiden' aufwärts über ,Tasso' bis zu den ,Wahlverwandtschaften', schreiben und gerade in diesem letzten noch die Macht der Liebe als eine eminente, schrankenlose Naturkraft schildern - denn ihm wurde das Geheimnis, das Wunder der Liebe offenbar! Und glaubst Du, beste Helene, dass man Dinge wie Tristan, Meistersinger oder Parzival nur mit der Phantasie und raffinierter Harmonik und Melodik schreibt oder meinst Du nicht auch, dass der, der einen Tristan schreiben konnte, an die Liebe mit überzeugtestem Vertrauen glauben mußte?!"[381]
Wie hypnotisiert ist Berg von Helenes Photographien, dem Tonfall ihrer Stimme, dem Ausdruck ihrer Augen, er möchte vor Liebe schreien, weinen und lachen wie ein Wahnsinniger [Ohne Datum (Mai 1908)] ,,Ich habe dein Salomebild vor mir und versenke mich in diese göttliche Anmut - - - Ewig und ganz Dein Alban. N.S. Ich sehne mich nach dem lieben Tonfall Deiner zärtlichen Stimme!"[382] „31. Mai 1909, Pfingstmontag (... ) es schreit in mir die Sehnsucht nach Dir, nach Deinen Gedanken, Deinen seelischen und körperlichen Reizen (... ) ich sehne mich plötzlich mit ungeheurer Macht nach Deinem Gesang - - nach Deiner göttlichen Stimme."[383] „15. Juli 1909. 0 lieb mich, Helene, bleib mir treu - - so stark und überzeugt wie ich Dich liebe und ich Dir treu bin! Ich schliesse, der Wagen wartet, und ich gedenke der schönen unvergesslichen Wagenfahrt im Donautal, wo ich derart von Glut und Zärtlichkeit für Dich geschwellt war, dass ich schreien und weinen und lachen hätte können wie ein Wahnsinniger (... ) ich bin ver rückt, irrsinnig vor Liebe und Sehnsucht nach Dir, Helene. Ich küsse Dich unendlich - Dein Alban."[384]
Helene Berg ist die Blumen-Frau, die Alban Feuerlilien und Veilchen schenkt, deren lichtdurchflutetes, wallendes Haar im Spiegel golden glänzt und deren verletzlicher Körper hinter Glas und im Wasser geborgen scheint. Wie kann Alban, der Gefangene seiner Liebe, ohne sie leben. Bringt er doch im Winter „per Schlitten" Liebesbriefe „auf die Post"[385] Wie gerne verweilt er an der Schwelle des Traumes und wie tief graviert er an einem Donnerstag im Frühling des Jahres 1909, Alban und Helenes Namen auf ewig ein ins Holz: ,,Das Fenster (... ) das drum auch unser beider Namen eingraviert trägt (... ) WiekannichohneDichIeben ! - - - ich bin ja ganz Dein."[386] Selbstversunken, seinsenthoben schreitet der Notenmacher - der lebenslang an Furunkeln leidet und dessen Fleisch vor Wespenstichen nicht gefeit war - neben der liebensbrennenden Ehefrau einher, bis am Horizont das himmelblaue Auge Hannas auftauchen wird. Im Unbekannten liegt eine große Versuchung und in der Gefahr eine große Wollust.
In den Briefen an Hanna Fuchs-Robettin hat Alban Berg alle möglichen Posituren des Verführers ausprobiert und eingenommen: eine schmeichelnde, eine verliebte, eine resignierte und eine verrückte. Gleich Pan im Schilf die Haut der Nymphe streift, beschwört Berg schon zu Beginn des Liebesbundes mit Hanna die physische Materialität des Briefes, nichts sucht er mehr als den Schimmer der Tinte: ,,Ahnst Du denn nicht, was das für mich bedeutete, eine Zeile, und sei es die belangloseste von Dir in Händen zu haben?! Ich kenne ja nicht einmal Deine Schrift!!! -."[387] An die Braut wird im Februar 1834 Georg Büchner schreiben: ,,Ich durste nach einem Briefe. Ich bin allein, wie im Grabe; wann erweckt mich Deine Hand."[388]
Buchstaben[389] zu küssen, davon schwärmt Denis Diderot am 31. August 1760 in einem Brief an Sophie Vollard: ,,Ich küsse deine letzten beiden Briefe. Dies sind Buchstaben, die Du geschrieben hast, und als Du schriebst, berührte Deine Hand die zu füllenden Zeilen und die Räume zwischen ihnen. Leb wohl, meine Liebste. Du wirst das Ende dieser Zeile küssen, weil ich es auch geküsst haben werde - hier und hier! Leb wohl."[390]
Alle die Schwüre, die zu Buchstaben gefroren waren und in Kuverts den Weg von Prag nach Wien genommen haben, alle die Zeilen Hannas sind verschwunden, kein einziges Schriftstück an Alban Berg hat sich erhalten: Kein Brief, keine Karte, kein Telegramm, nichts. Umso kostbarer ist ein Brief von Herbert Fuchs-Robettin, dem Ehemann Hannas, gerichtet an Alban Berg, datiert mit „Prag 26. Oktober 1925". Am gelben Briefbogen, links unten steht ein Name, ,,Hanna Fuchs" ist hier mit blauer Tinte geschrieben.[391] Wir tasten mit den Augen die Schwingungen und Schwebungen von Hannas Schriftzug ab und denken daran, was Ludwig Wittgenstein sagt: ,,(... ) Es ist, als ob der Name einEigenschaftswortwäre."[392]
Geht man der Korrespondenz Alban Bergs mit Hanna Fuchs umfassend die Jahre 1925-1934 nach - wird das erotische Fluidum von Zeile zu Zeile nachvollziehbar, die Chronik des „alljährlichen Lebens- und Liebeszeichen-Gebens"[393] ist in stilistischer Hinsicht ein Kabinettstück ergreifender Brief-Literatur. Die Tragik der Liebe, die Sehn sucht nach dem geliebten, fernen Menschen, die als Motiv in jede andere Form der Kunst quasi von Anbeginn an eingegangen ist, findet im letzten Brief geschrieben am weißgefrorenen[394] Wörthersee, zurückgezogen in die Regionen der Eisgebirge - eine beklemmende Intensität:
„14.12.34
Meine Hanna
Nach langer Zeit wieder einmal die Möglichkeit Dir zu schreiben. Almschi ist so lieb, Dir
diese Zeilen, die ich in der Elektrischen schreibe (die mich allein zu ihr bringt) zu übergeben.
In
diesen 1 1/2 Jahren, die wir uns nicht sprachen, hab' ich Dich - auch wenn Du den Eindruck haben solltest -
nicht vergessen. Wie könnte ich auch! Als ich Dir im Mai 1932 im ,Mahler'-Zimmer auf der Hohen Warte zuletzt
die Hand drückte, war es so, als wäre es acht Jahre vorher in Bubenec gewesen. Nichts, aber auch gar nichts
Trennendes lag in jener Zwischenzeit. Und so auch jetzt. Träfe ich Dich heute, wir sprächen und wären so
zueinander, als hätten wir uns erst gestern getrennt. Und doch haben wir uns endlos lange nicht gesehen,
haben nichts Direktes voneinander gehört und keine Geste verriet mehr unsere Zusammengehörigkeit. Und wie
lange noch??? In ein paar Wochen (am 9.1.) hab' ich eine Erstaufführung (meiner Symphonie) in Prag. Für mich
wäre es (da ich ja nicht in Berlin war) sogar eine Uraufführung. Nichts Naheliegenderes also, als in Prag
dabei zu sein- - - und damit bei Dir! Aber in unserer Liebe gibt es nichts Naheliegendes. Vom ersten
Augenblick an geschah nur das Entlegendste. Und selbst wenn wir einen ganzen Sommer lang fast Haus an Haus
wohnten, waren wir uns äußerlich nicht näher, als sonst in diesen - - - - 10 Jahren (Ja 10 Jahre werden es
im kommenden Jahr sein.) Und dabei sah ich Dich (in jenem Sommer 33) sogar zweimal, aber die Welt, die jeden
von uns umgab, trennte uns unerbittlich, und meine zaghaften Versuche, Dir einmal ganz allein zu begegnen,
mißlangen. Später im Winter suchte ich dann auf einem einsamen Spaziergang die Stätten auf, wo Du im Sommer
überall geweilt haben mochtest, und da ich die ganze Zeit über hoffte, auch Du würdest einmal - wenigstens
vom See aus vorüberfahrend - das ,Waldhaus' gesehen haben und mein großes Fenster, hinter dem mein
Schreibtisch steht- so war mir schließlich dieser Platz so wie hunderte in Prag und das Grand Hotel in Wien
und das Zimmer auf der Hohen Warte ein Ort, wo sich unsere Zusammengehörigkeit für ewige Zeiten manifestiert
hat. Umso stärker manifestiert hat, als ja keine Seele meiner Umgebung damals gewußt hat, daß Du mir so nah
bist und umso mehr, als dann (als ich erkennen mußte, daß Du Velden verlassen hast,) eine Einsamkeit für
mich anbrach, die nicht nur durch die menschliche Abgeschiedenheit des folgenden ganzen Jahres bedingt war,
sondern auch durch eine immer enger und dichter werdende Verkapselung meines tiefsten Inneren, das sich
schließlich- anders ist es nicht zu erklären: - Luft machte, indem es sich auf physisch qualvolle Weise
bemerkbar machte. (Der Arzt nannte es eine Störung des Herz-Nervs.) Jetzt bin ich wieder so ,gesund', daß
ich weiterhin einsam bleiben kann. Aber am 20. Mai 1935 - am unvergeßlichen Jahrestag - mußt Du so stark an
mich denken, daß das Gefühl der Einsamkeit für Augenblicke schwindet. Tu dies, meine Hanna".[395]
Die Landschaft rund um den Wörthersee wird zur Hanna-Landschaft. Die ganze Luft der Landschaft ist heilig. Berg hätte alle Schritte Hannas auf einer Karte einzeichnen können. Zwischen Selbstversunkenheit und erregenden Halbschlafphantasien treibt es ihn herum. Vorbei an den welken Rosengärten entlang des hohen Sommergrases, das zu brüchigen Halmen vertrocknet ist. Die Berge leuchten blau, die Luft ist rauh und brennt in den Augen, der See ist granatfarben, die Vögel in den Wolken[396] verborgen. Er glaubt, daß seine Liebe „unheilbar" sei, ,,unheilbar, weil an ihr nichts zu heilen ist":[397] Es ist besser tot zu sein, als ohne Liebe.[398]
Er betrachtet sich als einen Tumult[399] unzusammenhängenden Fleisches. Vom ziellosen Umherlaufen im Herbst 1935 sind die Fußsohlen wundgerieben und seit Monaten leidet er an einem Furunkel, dessen Eiterpfropt[4]°[400] wächst - als seine Temperatur zu steigen beginnt, kehrt er nach Wien zurück, es ist der 18.11.1935 und er wird an den Proben für die Aufführung der „Lulu-Symphonie" teilnehmen. Sein Puls geht schnell und schwach, das Eiter dehnt sich bis zum Platzen. Helene Berg wird den purpurroten Knoten aufstechen.[401] Am 17. Dezember 1935 liefert man den Komponisten ins Erzherzog Rudolph-Spital ein, hier stirbt er in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 1935 im Alter von fünfzig Jahren an Blutvergiftung.[402]
Ein Taschenkalender des Komponisten aus dem Jahre 1935/36 zeigt am 4. Februar 1936 die Eintragung „Lyr. Suite, New York". Alban Berg vermerkte mit stupender Genauigkeit während der Jahre 1926-1935 den Weg der „Lyrischen Suite" durch die Konzertsäle der Welt. Die Notate mit Bleistift oder mit Tinte ausgeführt, sind immer wieder grell mit Buntstiften eingekreist: Schöne, hypnotisierende Bilder des Begehrens und seiner unendlichen Beharrlichkeit.[403]
Wir haben einige Spuren freigelegt, wo Leben und Musik einander berühren, das eine sich zerstört, die andere sich konstruiert. In der Tonmenge der „Lyrischen Suite" sind die Geheimnisse der Liebenden wie in einem Felsen aufbewahrt. So hält, was wir lesen, unerschütterlich eine Mitte zwischen Entblößung und Verschleierung .
Mögen mit diesen Ausführungen einige verborgene Teile des sechssätzigen Streichquartettes erschlossen worden sein: Weder das Geheimnis seines Zaubers noch das Inkommensurable seiner disparaten Geschlossenheit sind damit geringer geworden. Wer sich dahin bewegt auf seiner Ton für Ton vor uns aufgerollten Bahn, spürt mit Erschauern, wie abgrundtief es zu beiden Seiten hinuntergeht. Gerne verbeugt man sich vor der bitteren Schönheit dieses Werkes.
Die Lyrische Suite - ,,Ein kleines Denkmal einer großen Liebe"[404] - mag in Musik, Dichtung und Architektur zahlreiche Entsprechungen finden. Als eines der schönsten Bauwerke der Welt gilt das Taj Mahal, das ein muslimischer Kaiser als Mausoleum für sich und seine Geliebte als Zeichen einer nie erlöschenden Liebe errichten ließ, und von dem ein indischer Dichter sagte, es sei eine Träne auf der Wange der Zeit.
In Friedrich Hölderlins Briefroman „Hyperion"[405] wandelt sich die angebetete Suzette Gontard zu „Diotima", der mantineischen Seherin, die in Platons „Gastmahl" selbst Sokrates belehrt. Sie ist die Priesterin erlösender, rettender Liebe. Hölderlin schuf diese Gestalt 1794, noch bevor er Suzette im Herbst des folgenden Jahres begegnete. Suzette Gontard, die Frankfurter Bankiersgattin und Mutter von vier Kindern, deren Hauslehrer Hölderlin war, ,,ist schön, wie Engel. Ein zartes geistiges himmlisch reizendes Gesicht! Ach! ich könnte ein Jahrtausend lang in seliger Betrachtung mich und alles vergessen, bei ihr, so unerschöpflich reich ist diese anspruchsvolle stille Seele (... ) alles ist in und an ihr zu einem göttlichen Ganzen vereint."[406] Doch die hymnisch gefeierte Liebe sollte an den gesellschaftlichen Schranken zerschellen. Im September 1798 verließ Hölderlin nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Jakob Friedrich Gontard die Frankfurter Kaufmannsfamilie. Der zweiunddreißigjährige Dichter wird in eine schwere Lebenskrise geraten und im Dezember 1801 von Nürtingen zur Winterreise über die französischen Alpen nah Bordeaux aufbrechen, wo ihm eine Hauslehrerstelle angeboten wird. Nach einem Fußmarsch von über 1000 Kilometer, dessen Strapazen die zerstörende Krankheit ausbrechen lassen, berichtet er am 28. Jänner 1802 der Mutter von den „gefürchteten überschneiten Höhen der Auvergne, in Sturm und Wildnis, in eiskalter Nacht und die geladene Pistole neben mir im Bette". Nach der Rückkehr aus Bordeaux, leichenblaß, abgemagert, von hohlem, wildem Auge, langem Haar und Bart, nach dem Schwindsuchtstod der dreiunddreißig Jahre zählenden Suzette Gontard, inmitten der völligen Aussichtslosigkeit noch irgend Verständnis für das Neue seiner Dichtung zu finden, schrieb der Dichter des „Hyperion" die Strophenfolge „Hälfte des Lebens".[407] Die Verse ziehen die Summe eines Lebensjahres, von dem aus das Dasein Hölderlins über fast vier Jahrzehnte[408] in ein langsames Erlöschen[409] geleitet wird.
HÄLFTE DES LEBENS
Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne, Und
trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm' ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der
Erde? Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.